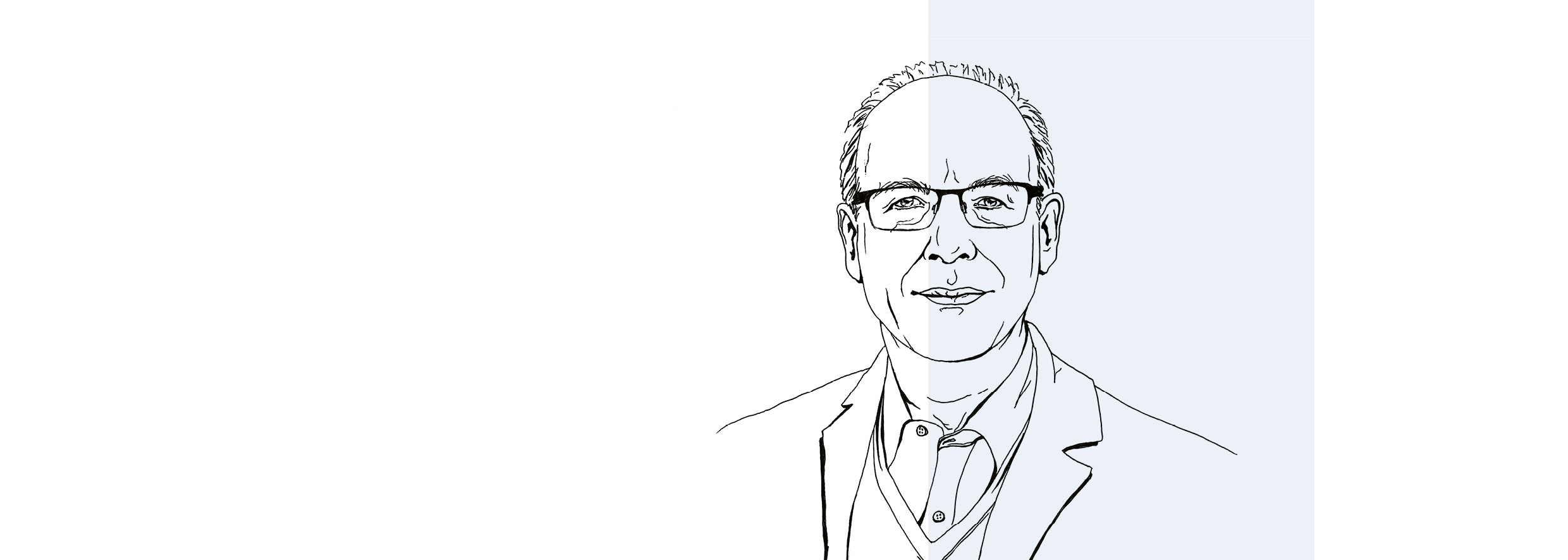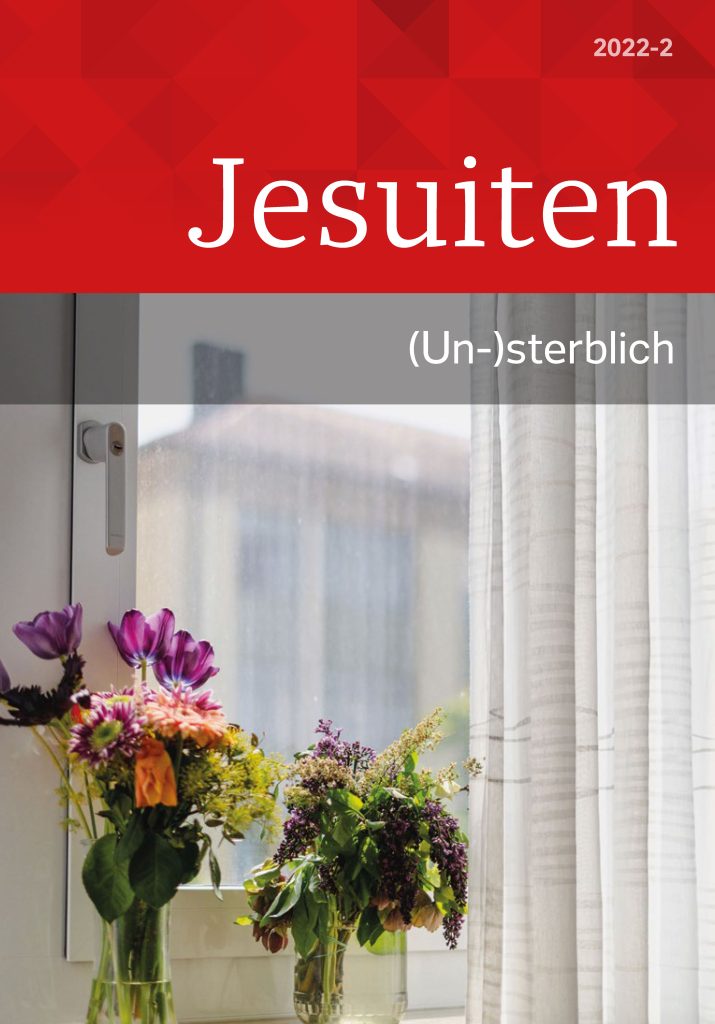Wie Gedenkorte Christen »rufen«
Klaus Mertes hat Bergen-Belsen besucht. Vor wenigen Tagen gedachten Bundespräsident Steinmeier und der israelische Staatspräsident Izchak Herzog dort der Toten des Holocausts. Klaus Mertes fragt sich, wie Gedenken in der Zukunft aussehen kann und ob Christen sich noch von „Anders-Orten“ rufen lassen.
Ich habe am vergangenen Wochenende Bergen-Belsen gesehen, zufällig nur ein paar Tage vor dem Besuch des israelischen Präsidenten Izchak Herzog, der mit dem Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers seinen Staatsbesuch in Deutschland abschloss.
Der Ort hat mich sehr beeindruckt. Und das ist eher schwach formuliert.
Er sieht äußerlich ganz anders aus als etwa Ausschwitz. Und doch ist das Durchganslager tief mit dem Vernichtungslager verbunden. Schließlich war es dann, wie unsere Begleiterin formulierte, die „Endstation der Endlösung“.
Keine Baracken sind zu sehen, dafür eine weite Fläche mit leicht erhobenen, quadratischen Hügeln über Massengräbern. Ein jüdischer Gedenkstein und ein polnisches Holzkreuz wurden in der unmittelbaren Nachkriegszeit errichtet, der Obelisk vor der Inschriftenwand ragt heraus, einzelne kleinere Gedenksteine stehen verstreut im Gras, ein konfessionsneutrales „Haus der Stille“ wurde im Jahre 2000 errichtet und steht unter Baumzweigen versteckt am Rande des Geländes.
Wie sieht das Gedenken in der Zukunft aus?
„Wir“, das war eine Gruppe, die vom Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer zusammengerufen war, um die einige Kilometer entfernte katholische „Sühnekirche“ zu besuchen, die 1961 auf Initiative der katholischen Bevölkerung in der Stadt Bergen errichtet und eingeweiht wurde. Da sie weit genug von Bergen-Belsen steht, entstand nie das Gefühl der Vereinnahmung, dafür aber ein lebendiges geistliches Band, das auch in der Gedenkstätte Bergen-Belsen geschätzt wird. Die Sühnekirche steht aber heute vor einer Frage, vor der andere Gedenkorte wie Maria Regina Martyrum in Berlin oder Dachau vielleicht auch in einigen Jahren stehen werden: Was ist die Zukunft des Gedenkens, genauer: Der geistlichen Reaktion auf unsere „Anders-Orte“ in Deutschland wie Plötzensee, Bergen-Belsen, Esterwegen oder Dachau.
Die Gemeinden vor Ort werden kleiner und älter. Sie können es immer weniger tragen. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind meist verstorben. Ordensgemeinschaften spürten nach dem Krieg den Auftrag, auf diese Orte existentiell zu reagieren – was konkret auch bedeutete: Sich dort anzusiedeln und sich dem Ruf des Ortes zu öffnen. Auch diese Gemeinschaften werden kleiner, und gesamtkirchlich herrscht auch nicht mehr die Atmosphäre, die zum Beispiel 1958 zum Wunsch eines ganzen Katholikentages führte, eine Gedenkkirche für die Opfer des Nationalsozialismus in Berlin zu errichten, Regina Martyrum, eine Gedenkkirche, die der Laienkatholizismus und der diözesane Klerus in den letzten Jahrzehnten immer mehr vergaß.
Was ist die Zukunft unserer Anders-Orte in Deutschland? Oder genauer:
Was ist die Zukunft der kirchlichen Reaktion auf diese Orte?
Die Frage beschäftige uns zusammen mit dem Hildesheimer Bischof nach dem Besuch von Bergen-Belsen und der Sühnekirche in Bergen.
Anders-Orte, die infrage stellen
Natürlich geht es auch um Investitionen in Gebäude und Personal. Aber ohne eine existentielle Komponente wird auch Geld nichts nützen. Anders-Orte wie Bergen-Belsen „rufen“ in die physische Nähe und in die Zumutung der Befremdung zugleich. Sie sind „in die Gesellschaft hineingezeichnet, sozusagen Gegenplatzierung oder Widerlager“; dort sind „die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet“ (Michel Foucault).
Deswegen: So sehr die Anders-Orte äußerlich am Rande liegen mögen, so sehr stellen sie die ganze Gesellschaft, und, was den Umgang mit den Gedenkkirchen betrifft, die ganze Kirche vor eine Entscheidungsfrage:
Wo sind heute die Menschen, wo sind die Christgläubigen, die bereit sind, sich von Orten wie Bergen-Belsen rufen zu lassen?
Der Ruf ist jedenfalls da.