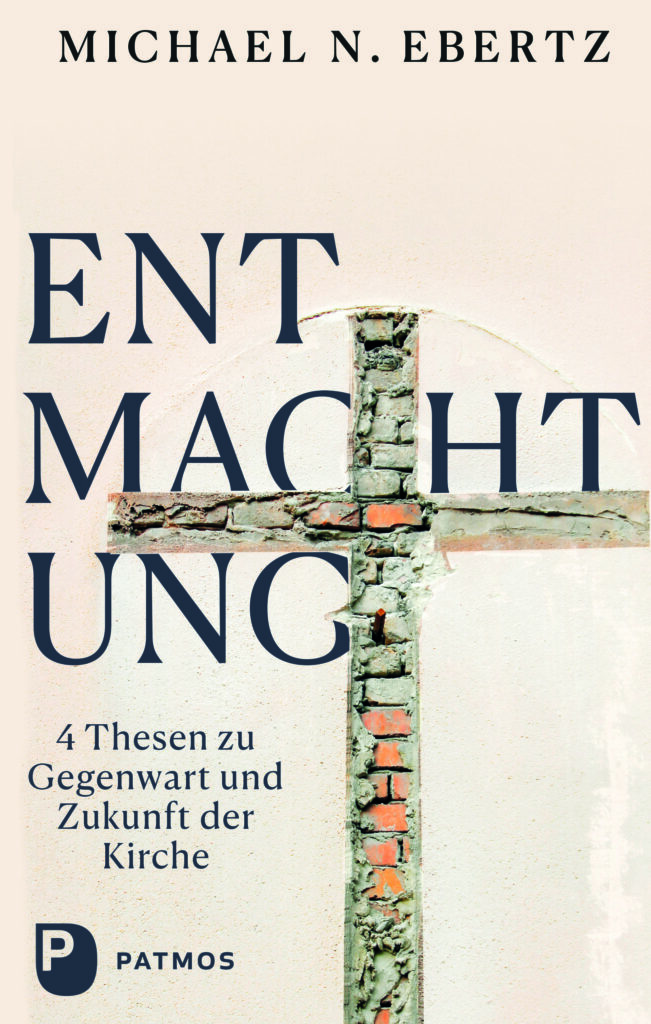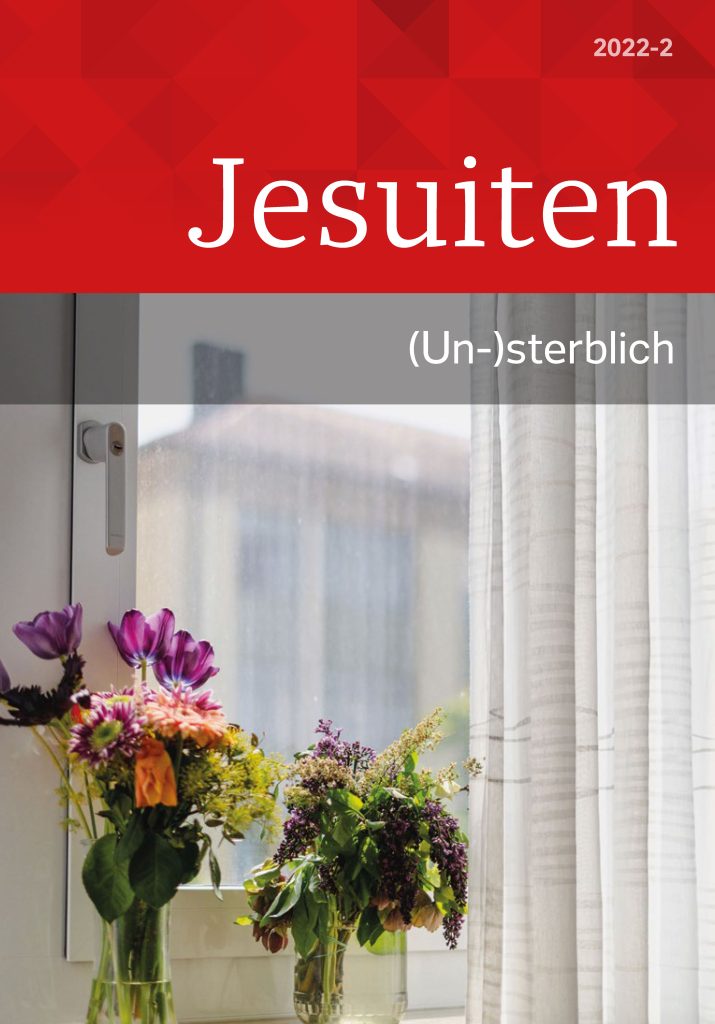Wie Kirche es schafft, sich zu verändern
Kirche braucht einen Neuaufbruch – so die weit verbreitete Forderung. Aber wie schafft es Kirche, sich aus den immergleichen Perspektiven und Denkstilen zu befreien? Der Theologie und Soziologe Michael N. Ebertz zeigt, wie Kirche zu Lernprozessen käme – und führt den Begriff der »Arenen« ein.
Im Wissen, dass die unmittelbare Verständigung zwischen Anhängern unterschiedlicher Denkstile, gelinde gesagt, schwierig ist, scheint es mir notwendig, darauf hinzuarbeiten, den kirchenoffiziell vorherrschenden Denkstil und Denkzwang zu transformieren und damit die Lernfähigkeit im kirchlichen Feld zu steigern. Ihm wird eine ‚trained incapacity‘ diagnostiziert.
Zwar könne man „nicht mit vollem Ernst behaupten“, so einmal der niederländische Soziologe Leo Laeyendecker, „eine kirchliche Organisation mit einem Lebensalter von fast 2000 Jahren besäße keine Lernfähigkeit. Ihre heutige Form ist ja gerade das Resultat eines Lernprozesses, der in vieler Hinsicht auch außerordentlich gut gelungen ist“. Aber, so schreibt er weiter,
„das Problem liegt anderswo. Es bezieht sich auf ein Paradox. Der Erfolg dieses gelungenen Prozesses steht einem neuen und radikalen Lernen im Wege. Die alten Methoden genügen den veränderten Umständen nicht länger. Die Kirche ist also das Opfer ihres Erfolgs […] Ihre Lernfähigkeit ist zwar nicht völlig verschwunden, aber doch beträchtlich eingeschränkt worden“.[1]
Arenen der Multiperspektivität
Um dieser Einschränkung entgegenzuwirken, schlage ich vor, auf vielen Ebenen im kirchlichen Feld Arenen der Multiperspektivität zu implementieren. In diesen Arenen – ich meide bewusst den Ausdruck Synode – wären themen-, lösungs- und entscheidungsorientierte Dialoge zu führen, und sie wären nicht bloß temporär zu initiieren, sondern auf Dauer zu stellen und – je nach Entscheidungsmaterie – zwischen allen Ebenen der Kirche miteinander zu verknüpfen.
In ihnen wären nicht nur Theologenkommissionen zusammenzubringen, sondern auch Laien, die ja als Individuen „mehreren Denkgemeinschaften“[2] angehören. Als Repräsentant*innen unterschiedlicher gesellschaftlicher Felder sind sie dazu fähig, Denkzwänge aufzubrechen, eingefahrene Denkstile zu ergänzen, zu erweitern und umzuwandeln, aber auch die an den Spitzen von Organisationen herrschende und unüberwindbare „Knappheit von Bewußtsein“[3] zu überwinden. Es geht somit um den Einbau der Blicke von ‚außen‘, um die Wertschätzung des ‚fremden Blicks‘, ja darum, in zivilisierter, d. h. geregelter Weise ganz gezielt auch ‚Anders-‘ und ‚Gegenkräfte zu aktivieren‘.[4]
Lernen könnte darüber offensiv und in anderer Weise als bisher gestaltet werden. Lernen darf (nicht nur) defensiv, beharrend und im Zweigenerationenrhythmus nachklappend, vor allem dazu dienen, die institutionelle Selbststabilität zu befördern und externe Bedrohungen abzuwehren. Es müsste vielmehr darauf gerichtet sein, solche ‚Bedrohungen‘ in kollektive Reflexionsanstöße zu verwandeln, die in – auch dezentrale – Entscheidungen münden.
Das hat nichts mit ‚modischer Anpassung an den Zeitgeist‘ oder Bedrohung der ‚Einheit‘, sondern damit zu tun, Verluste an wertvollen Erfahrungen zu vermeiden und zu verhindern, dass die offizielle Kirche repetitiv museale, ja fossile Sätze produziert. Zweck ist eine kontinuierliche und sich steigernde Lernfähigkeit der katholischen Kirche. Der ‚Synodale Weg‘ in Deutschland wird dieser Leitidee der Multiperspektivität ansatzweise, aber eben auch nur so, gerecht. Dies gilt auch für die meisten anderen kirchlichen Gremien, weil sie nicht alle relevanten Milieus repräsentieren.
Buchempfehlung:
Dieser Essay ist ein Auszug aus dem Buch »Entmachtung. 4 Thesen zu Gegenwart und Zukunft der Kirche« (Patmos Verlag Ostfildern 2021). Der Text stammt aus Kapitel 3.3 Ausblick: Multiperspektivität, Seiten 113–116.
Zum Buch
Aus den Familien kommt der Nachwuchs für die Kirche nicht mehr wie früher. Die Kirche hat die Lufthoheit über Körper, Geist und Seele der Einzelnen verloren. Entsprechend bunt sind ihre Mitglieder zusammengesetzt, die ihrerseits mit der pluralen Gesellschaft verflochten sind. Die Debatten zeigen, dass der Sinn von Kirche nicht mehr klar ist. Sie werfen die Frage auf, welche Möglichkeiten sich eröffnen, Menschen zu einer christlichen Lebensführung zu bewegen.
Michael N. Ebertz beschreibt nicht nur diese existenziellen Zäsuren, sondern analysiert die Hintergründe und Zusammenhänge der Entmachtung der Kirche – und skizziert die Richtung möglicher Wege in eine Zukunft.
„Lebensform des Wechsels“
Indem neben die Leitwährung der Attraktivität (vgl. These 1) und die Leitidee der Wertorientierung und Inklusion (vgl. These 2) die der dialogischen Multiperspektivität tritt, könnte auch Abwanderung (‚exit‘) im quantitativen Sinn gebremst werden, da im kirchlichen Feld zunehmend damit zu rechnen ist, in Zukunft noch stärker vom Modus des ‚Ausweichens‘, der für die heutigen Lebensformen typisch geworden ist, betroffen zu sein, als es ohnehin schon der Fall ist.
Diese vorherrschende Kultur, welche die „Lebensform des Wechsels“ präferiert, steht konträr zu einer „Kultur, die das Opfer sucht“ und menschliches Schicksal, Leiden und Tradition einfach hinnimmt.[5] So wählen viele Kirchenmitglieder ganz unterschiedliche Formen des Ausweichens, treffen die Option des Disengagements, resignieren, machen sich rar, ziehen sich heraus, auch aus ihren bisherigen ‚Kirchenfalten‘. Oder sie treffen die Exit-Option, weil ihre Stimme (‚voice‘) nicht erfragt, nicht gehört und schon gar nicht erhört wird.[6] Was hätten sie auch – außerhalb der Kirchenverwaltungen, wo sie bürokratisch bearbeitet werden –, für eine ernstzunehmende Adresse? Wohin sollen sie sich wenden?
Eine andere Form des Ausweichens besteht darin, über die Verbreitungsmedien die Stimme zu erheben und somit kirchliche Themen auch nach Stil und Ausdrucksweise so in die eigendynamischen Arenen der gesellschaftlichen Öffentlichkeit zu ziehen, dass sie dem Image des kirchlichen Feldes und seiner Akteure schaden.
Die Kirche selbst leidet einen Verlust, wenn sie die Ausweich-Optionen gerade derer befördert, die eine hohe Motivation aufbringen, ihre Stimme zu erheben, weil ihnen – aus welchen gemischten Motivationen auch immer – die Zukunft der Kirche etwas bedeutet.
Ihre vielfältigen Wahrnehmungen und Erfahrungen – auch die von Minderheiten – können als Anregung für Veränderungen wertgeschätzt werden. So sind, denke ich, Bedingungen auch mitgliedschaftlicher Mitbestimmung und Führungsausübung zu schaffen, die weit über das hinausgehen, was den heutigen kirchlichen ‚Gremien‘ an Mitwirkungsmöglichkeiten zugestanden wird.
[1] Laeyendecker, Die beschränkte Lernfähigkeit der Kirchen, 104.
[2] Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, 144.
[3] Luhmann, Der neue Chef, 93.
[4] Vgl. Hirschman, Abwanderung und Widerspruch, 13.
[5] Dirk Baecker, Welchen Beitrag kann die Kultur zur Bewältigung der Corona-Krise leisten?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 2021, 19–26, 19.
[6] Die Exit-Option kann sogar durch allerhöchste Amtsvertreter nahegelegt werden. So habe Papst Franziskus Sr. Katharina Ganz „stellvertretend für alle Ordensoberinnen“ geraten, „sie [sic!] könnten sich eine ‚andere Kirche‘ machen, wenn Sie mit den Zulassungsbedingungen zum Weiheamt nicht einverstanden seien“; vgl. Katharina Ganz im Interview mit Daniel Deckers: „Frauen müssen die Machtfrage stellen“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.09.2019, 4.
Foto: © CL/photocase.com