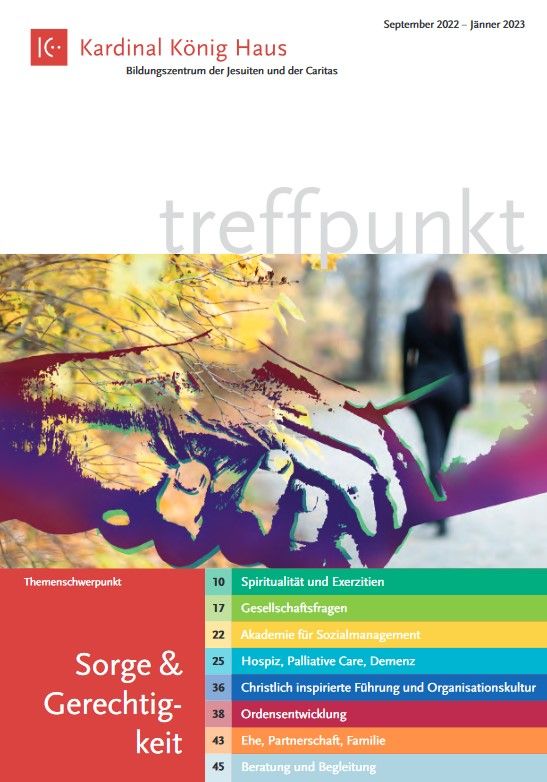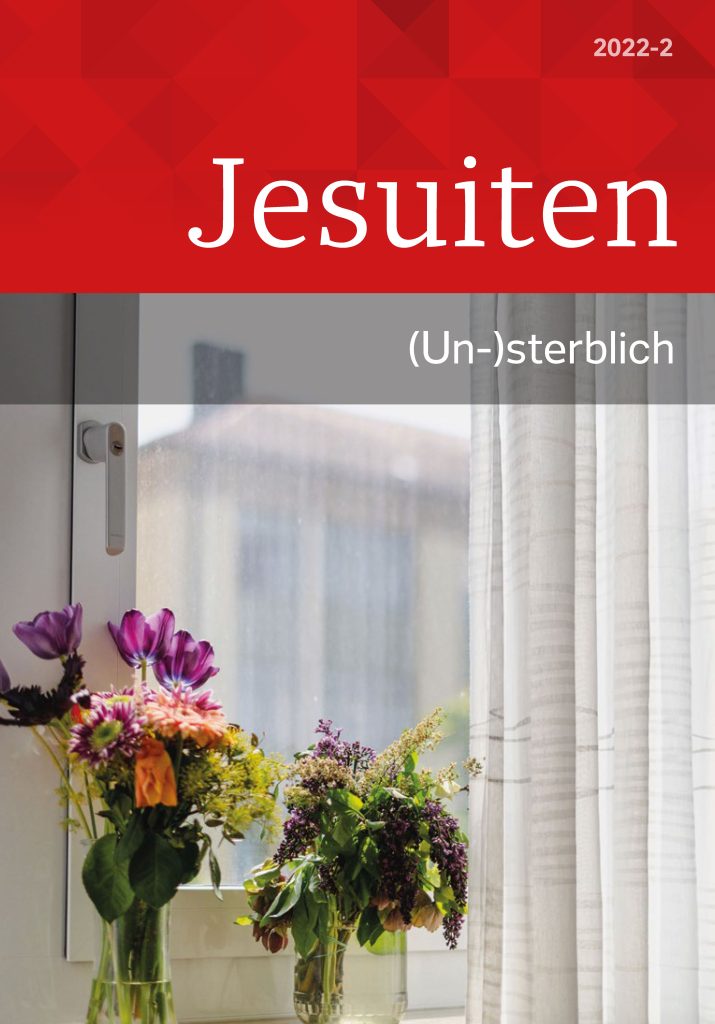Über Zeitarmut und Zeitgerechtigkeit bei pflegenden Angehörigen
Wenn über Armut und soziale Ausgrenzung gesprochen wird, dann denken die meisten zuerst an Geld, vielleicht dann an Wohnen, Kleidung oder Essen. Das Thema „Zeitwohlstand“ oder „Zeitarmut“ ist keines, das in der Armutsberichterstattung oder in Diskussionen über Gerechtigkeit viel Raum einnimmt. Eva Fleischer ist Professorin für Soziale Arbeit und setzt sich mit der Initiative Care.Macht.Mehr dafür ein, dass die Ungerechtigkeit endlich ein Ende hat.
Zeitwohlstand ist – egal ob bei der Erwerbsarbeit oder der Haus- und Sorgetätigkeit – mehr als das Gegenteil von Zeitarmut. Zeitwohlstand umfasst die Dimensionen der Zeitsouveränität (selbstbestimmte Zeitverwendung in Bezug auf die Dauer, das Tempo und die zeitliche Lage), der Planbarkeit, der Synchronisierung (gute Abstimmungsmöglichkeiten unterschiedlicher zeitlicher Anforderungen) sowie ausreichend freie Zeit. Freie Zeit ohne Verpflichtungen ist Voraussetzung für Muße und Selbstfürsorge.
Zeitgerechtigkeit meint, dass für alle im Alltag – im Jetzt und im Lebenslauf – gleiche zeitliche Verwirklichungschancen vorhanden sein sollten.
Das Wohlbefinden und die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben von sorgenden An- und Zugehörigen hängen ganz wesentlich davon ab, inwiefern die Person die Verantwortung und die Arbeit mit anderen teilen kann. Dies hat wiederum damit zu tun, über welche Ressourcen die Person verfügt: Gibt es andere An- und Zugehörige, die in der Nähe sind und auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen? Hat sie genügend Geld, um unterstützende Dienste zukaufen zu können oder Erwerbsarbeit reduzieren zu können? Verfügt sie über das notwendige Wissen und die Kompetenzen, um sich die entsprechenden Angebote organisieren zu können?
Weiter spielt eine Rolle, inwieweit die Person mit Care-Bedarf bereit ist, sich von anderen Angehörigen oder professionellen Diensten unterstützen zu lassen oder welche Angebote in der Region überhaupt vorhanden sind. Ebenfalls von Einfluss sind Rollenerwartungen, die besonders Frauen nahelegen, die Pflege und Betreuung von Nahestehenden zu übernehmen und ihre eigenen Interessen zurückzustellen.
Zeitwohlstand bringt Lebensqualität
Zeitwohlstand ist eine zentrale Dimension für die Lebensqualität der pflegenden Angehörigen. Je nach Pflegestufe kann die zeitliche Belastung enorm variieren. Besonders erschwerend wird es für Betroffene, wenn die Person mit Care-Bedarf (fast) rund um die Uhr Zuwendung braucht. Dabei braucht meist nicht nur die Pflegeaktivität selbst Zeit, neben der Betreuung und Pflege sind in ständiger Bereitschaft und unter Zeitdruck auch Hausarbeitstätigkeiten wie Einkaufen, Kochen, Reinigen, Wäsche waschen und Reparaturen zu erledigen.
Die Wohnung kann nicht einfach so verlassen werden und die unterstützte Person kann nicht einfach mitgenommen werden, wie dies bei Babys und Kleinkindern möglich ist, die eine ähnliche Präsenz erfordern. Damit können simpel anmutende Aktivitäten wie Einkaufsfahrten oder die eigene Vorsorgeuntersuchung zu logistischen Herausforderungen werden, von Wochenendausflügen, Urlauben und spontanen Sozialkontakten ganz abgesehen.
Das Nicht-Verfügen über die eigene Zeit macht sich auf mehreren Ebenen bemerkbar: Das fängt mit der Frage an, ob Nachtruhe gegeben ist oder ob mehrfach in der Nacht aufgestanden werden muss, geht weiter zur Frage, inwieweit eigene Erholungszeiten, Zeiten für psychische und physische Regeneration, z. B. durch Hobbys oder soziale Kontakte gewährleistet sind. Für Erwerbstätige ist insbesondere die Erwerbsarbeit nicht in dem Maß aufrechtzuerhalten, wie sie es gerne hätten, sie reduzieren die Arbeitszeit, teilweise organisieren sie die bezahlte Arbeit um die Pflege- und Betreuungstätigkeit herum, um z. B. die ständige Abrufbereitschaft unterbringen zu können.
Ein siebzigjähriger Rentner, der seine an Parkinson erkrankte Frau pflegt, sagte in einem Forschungsprojekt zum Thema Angehörigenpflege:
„Dem Arzt habe ich so erzählt, wie es bei uns läuft. Dann hat er eben gesagt: ‚Naja. Wenn ich in deiner Situation wäre, ich würde mir wie ein Kettenhund vorkommen.‘“ Dann hab ich mir gedacht: ‚Das ist ganz schön stark.‘ (lachend). Aber irgendwo stimmt es (lachend).“
Zeit für sich ist wichtig
Zeit für sich, das ist nicht nur die Zeit, um Hobbys nachzugehen oder auch einfach einmal nichts zu tun, das ist auch die Zeit, um sich weiterzuentwickeln, es ist auch die Zeit, um sich in die Gesellschaft einzubringen. Menschen – und überwiegend sind es Frauen –, die sich in einem Maß für andere verausgaben, dass keine Zeit mehr für sich selbst überbleibt, haben nicht nur mit gesundheitlichen Folgeerscheinungen zu kämpfen, sie sind auch ein blinder Fleck in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie fehlen ebenfalls in der politischen Arena, weil sie keine Zeit (und keine Kraft) haben, um ihre Stimme zu erheben.
Lebenslauforientierte Zeitgerechtigkeit und Zeitwohlstand sollten als zusätzliche Aspekte in die sozialpolitische Diskussion Eingang finden. Karin Jurczyk und Ulrich Mückenberger haben ausgehend von den realen Zeitaufwendungen das Optionszeitenmodell entwickelt. Der Grundgedanke ist, dass Menschen im Lauf ihres Lebens ein Zeitvolumen von sechs Jahren für Care-Tätigkeiten, von zwei Jahren für Weiterbildung sowie ein Jahr für eine persönliche Auszeit mit sozialrechtlicher Absicherung zur Verfügung stehen sollte. Das detailliert ausgearbeitete Modell verfügt über spezifische Mechanismen, um mehr Zeitgerechtigkeit zu erreichen, z. B. ein erhöhtes Zeitbudget für Alleinerziehende oder Verfall von nicht-konsumierten Care-Zeiten. Mit diesem Modell wird die Vision eines Lebens mit vielfältig erfüllter Zeit vorstellbar.
Dieser Text ist zuerst erschienen im „treffpunkt“, dem Magazin des Kardinal König Hauses in Wien.
Am 9. September 2022 diskutiert Eva Fleischer am Podium beim Symposium „Care und Gerechtigkeit Getrennte Pole oder zwei Pfeiler einer Brücke?“ im Kardinal König Haus.
Illustration: © Tatiana Sidenko/istock.com