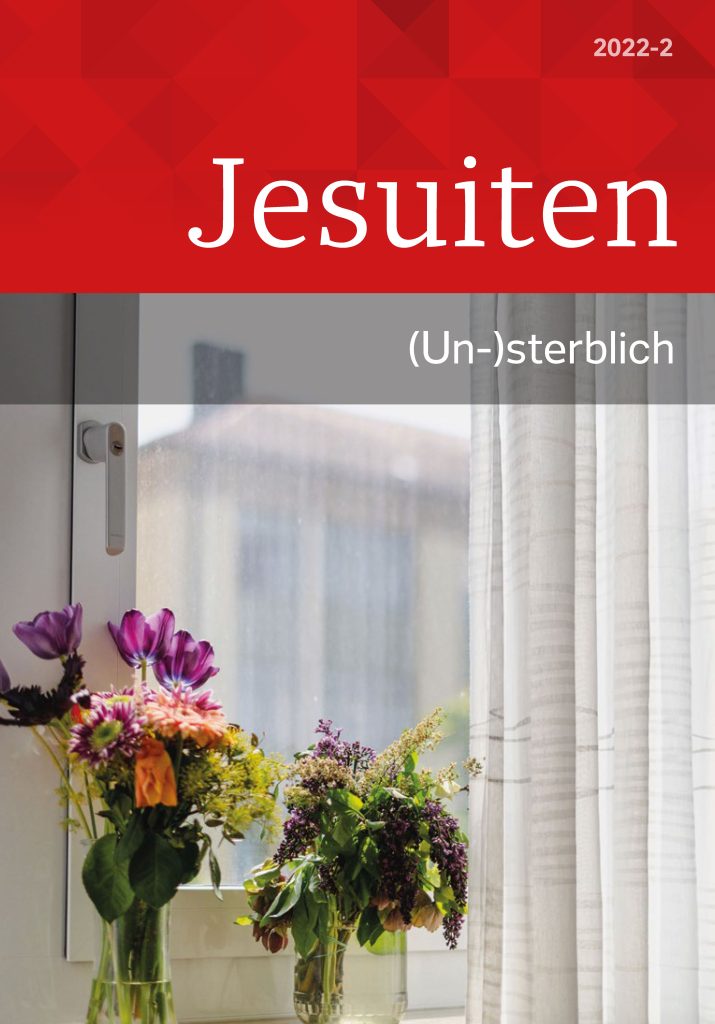Ein Besuch bei den tanzenden Derwischen
Die Reise zu den Derwischen führt nach Konya. Die 2,3 Millionen-Einwohner-Stadt in Anatolien beherbergt das Mausoleum des Philosophen, Dichters und islamischen Gelehrten Mevlana Dschalar ad-Din Rumi, international einfach als Rumi bekannt. Er schloss sich dem Sufismus an, einer mystischen Bewegung innerhalb des Islams, die die Vereinigung mit Gott zum Ziel hat.
Rumi wurde 1207 im heutigen Afghanistan geboren und starb 1273 in Konya. Schon damals sah er über den Tellerrand des eigenen Glaubens hinaus und forderte Frieden, Brüderlichkeit und Liebe gegenüber allen Menschen ungeachtet ihrer Religion. „Liebe ist frei von der Enge der Gebetsnische und des Kreuzes“, lautet eine seiner Kernbotschaften, die heute aktueller denn je ist. Nach seinem Tod bildeten seine Anhänger den Orden der Mevlevi-Derwische und entwickelten auf der Suche nach göttlicher Liebe und Wahrheit das Ritual der tanzenden Derwische.
„Komm und komm wieder, wer immer du bist
Rumi
Ungläubiger, Feueranbeter oder Götzendiener
Hier ist das Tor zur Hoffnung, komm so, wie du bist.“
Von weither kommen Gläubige nach Konya, um Rumi zu verehren und mehr über seine Spiritualität zu erfahren. Ihr Ziel ist das Hauptkloster der Mevlevi-Derwische im Stadtzentrum Konyas mit Rumis Grab. Seit 1925 ist es allerdings ein Museum – Atatürk verbot damals die religiösen Orden, die für ihn nicht mit einer säkularen Gesellschaft und modernen Türkei vereinbar waren. Seit der Mitte der 1950er Jahre dürfen die Derwische wieder tanzen, allerdings nicht als Religionsausübung, sondern als Tänzer bei kulturellen Veranstaltungen.

Immaterielles Kulturerbe der UNESCO
So auch in Konya. Ein paar hundert Meter vom Kloster-Museum entfernt lassen die Derwische die alten Traditionen im Kulturzentrum lebendig werden. Zwei-, dreimal in der Woche wirbeln sie hier über den Boden. Seit 2008 steht ihre Zeremonie übrigens auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO.
Der Eintritt ist kostenlos, Karten sind erst kurz vor Beginn erhältlich. Um kurz vor acht Uhr ist es dann so weit – die Türen öffnen sich in einen hohen Raum, in der Mitte eine achteckige Fläche, umgeben von einem Geländer. Ein mehrköpfiges Orchester sitzt an einer Seite. Dann öffnet sich ein Tor in der Umrandung und mit feierlichen Schritten bringt ein Mann ein rot gefärbtes Schafsfell herein. Er legt es gegenüber des Orchesters auf den Boden und verlässt die Fläche wieder. Das Fell symbolisiert den mit Gott vereinigten Rumi und ist das erste von zahlreichen mystischen Symbolen in der Derwisch-Zeremonie.
Unter den knapp 200 Zuschauern aus aller Welt, die zum Teil extra für die Derwisch-Zeremonie angereist sind, macht sich gespannte Erwartung breit. Endlich ziehen die Derwische ein, schweigend und gemessenen Schrittes. Acht Männer sind es, gehüllt in lange schwarze Mäntel, auf dem Kopf die hohen beige-braunen, kegelförmigen Hüte. Ihnen voran geht der Scheich, der auf dem roten Fell Platz nimmt.

Dann beginnt die Zeremonie, Sema genannt, mit der Rezitation von Koransuren. Daran anschließend setzt die traditionelle mevlevitische Musik ein und die Derwische legen ihre schwarzen Mäntel und damit ihr irdisches Leben ab. Darunter kommen lange weiße Gewänder mit weiten Röcken zum Vorschein. Sie symbolisieren die weiße Kleidung, die Muslime bei ihrem Tod tragen, und stehen für die Neugeburt im Paradies. Den hohen Hut behalten die wirbelnden Männer beim Tanzen auf dem Kopf.
Derwische sind linksdrehend
Einer nach dem anderen schreitet zum Scheich, der auf dem roten Fell steht. Der symbolische Platz wird dabei mit einer tiefen Verbeugung gegrüßt, wobei die Arme überkreuzt und an die Schultern gelegt sind, was sich während der Zeremonie immer wieder wiederholt. Mit einer Verbeugung schickt der Scheich die Derwische auf die Tanzfläche. Langsam beginnen sie sich zu drehen, immer um die eigene Achse und immer in Linksrichtung, also in Richtung ihres Herzens, und immer gegen den Uhrzeigersinn. Sind die Arme zunächst vor dem Oberkörper verschränkt, erheben die Derwische sie nach und nach immer mehr, bis sie zum Himmel zeigen.
Sie wirbeln um die eigene Achse, immer schneller, die weißen Gewänder schwingen um die Tänzer. Ihre Drehgeschwindigkeit spüren die Zuschauer deutlich am erzeugten Wind. Die linke Hand zeigt dabei zur Erde. Tanzrichtung und Haltung kommen nicht von ungefähr – mit der nach unten weisenden Hand leitet der Derwisch die göttliche Botschaft an die ganze Schöpfung weiter. So wie die Planeten um die Sonne kreisen, kreisen die Derwische um ihr Herz und empfinden die Drehungen der Planeten nach.
Durch das Herumwirbeln streben die Derwische danach, in Trance zu fallen, um zu mehr Erkenntnis über sich zu kommen und letztendlich eins mit Gott zu werden.
Drei Runden dauert der Tanz der Derwische. Es ist faszinierend, wie sie nach dem minutenlangen Herumwirbeln sofort ruhig stehen können. Die Zeremonie endet, wie sie begonnen hat, mit Koransuren. Danach hüllen sie sich wieder in ihre schwarzen Mäntel und verlassen den Raum. Schweigend und in Meditation.