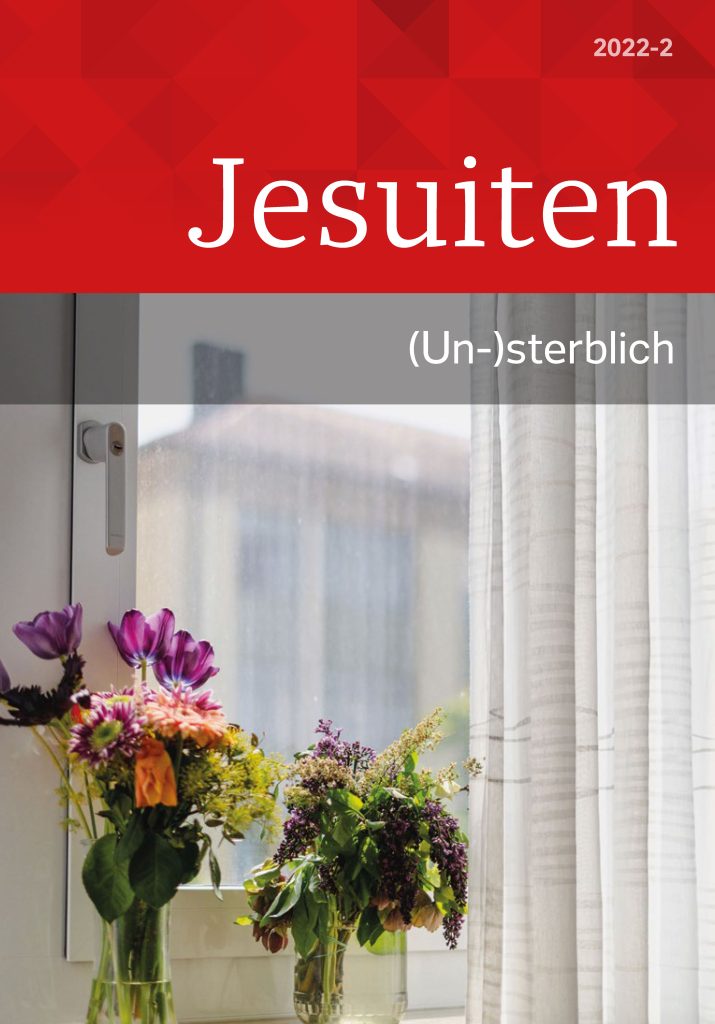Warum das Licht von Weihnachten immer mit der Dunkelheit verbunden ist
Weihnachten ist geprägt vom Lichtmetaphern und Lichtblicken. Gotthard Fuchs zeigt aber: Es ist ein Fest, das ohne den Bezug auf die Dunkelheit nicht auskommt – und erst so an Tiefe und Bedeutung gewinnt.
„Wahrlich, keiner ist weise,
der nicht das Dunkel kennt,
das unentrinnbar und leise,
von allen ihn trennt.“
Diese Erfahrung Hermann Hesses teilt wohl mancher, der nachts nicht schlafen kann und den Morgen wie eine Erlösung begrüßt: Mitternacht als Anbruch des Tages schon. Im Jahreskreis ist bekanntlich keine Zeit dunkler als die um die Wintersonnenwende, nie sind die Tage kürzer. Man könnte die gesamte Kultur- und Religionsgeschichte am Leitfaden dieses elementaren Motivs erzählen: dem Kampf von Licht und Finsternis! „Und die im Dunklen sieht man nicht.“ Mitternacht als Kipppunkt, tiefer hinein in die Finsternis geht’s nicht – aber dann doch hindurch: Sonnenwende als Geburt des neuen Jahres und Lebens!
Am Tiefpunkt
Kein Wunder, dass die römischen Christen Anfang des 4. Jahrhunderts den astronomischen Tiefpunkt des Jahres zum Datum für die Geburtstagsfeier Jesu wählten. Soll er wirklich der Sonnenkönig sein, dann muss er von Anfang den Gang durchs Dunkel gewagt haben, hinabgestiegen bis in den Stall und in all das Dunkel danach – als müsste erst das ganze Ausmaß der Jahresdunkelheit bis zum letzten durchschritten und erschöpft sein.
„Als tiefes Schweigen das All umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da sprang dein allmächtiges Wort vom Himmel, vom königlichen Thron herab als harter Krieger mitten in das dem Verderben geweihte Land.“ (Weisheit 18,14) Förmlich befreiungstheologisch ist in dieser frühjüdischen Schrift aus der Zeit Jesu vom siegreichen Durchbruch des Lichtes die Rede, von der aufklärenden Kraft göttlicher Weisung.
„Ich lag in tiefster Todesnacht,
du warest meine Sonne,
die Sonne , die mir zugebracht,
Licht, Leben, Freud und Wonne.“
So dichtete Paul Gerhardt angesichts von 30jährigem Krieg und persönlicher Not Krippe und Kreuz zusammen. Warum hat gerade das Dietrich Bonhoeffer im Nazigefängnis 1943 so getröstet, und so viele andere auch?
„Durchschmerzen“ und „Erscheitern“
Nicht zufällig ist Nacht ein Zentralbild christlicher Mystik geworden: Im Jahrhundert der großen Pest nennt Johannes Tauler das Christwerden „die Arbeit der Nacht“, und ein Dag Hammarskjöld nimmt zustimmend das alte Glaubensbild von der dunklen Nacht zur Bewältigung und Gestaltung politischer Verhältnisse auf.
Nicht im Vermeiden des Dunklen liegt die Befreiung, sondern im Durchschmerzen und „Erscheitern“.
Groß steht deshalb am Beginn der neueren Glaubensgeschichte Therese von Lisieux, die mitten in ihrer wachsenden Jesusverbundenheit doch die Erfahrung totaler Gottesfinsternis macht: alle Gewissheit wird ihr genommen, überall droht „nur eine noch tiefere Nacht, die Nacht des Nichts“.
Darin aber entdeckt sie den bedürftigen Jesus im Kreise der Armen und Gott-Losen, sie wird zur Schwester „vom Kinde Jesu“ – das völlige Gegenteil von Kitsch und Kinderei. Sie entdeckt den kleinen Weg wirklicher Gottesliebe im Nächstliegenden, in der Banalität des Alltäglichen und in realer Not (wie später ihre Namenstochter Teresa von Kalkutta und so viele andere).
Wer Weihnachten wirklich feiert und zur Krippe geht, entschließt sich zur Lebens- und Zeitenwende; er oder sie erzählt alle Geschichte(n) nun bewusst „nach Christi Geburt“, und die wird zur Zeitrechnung ihres Lebens.
Foto: © Allan Mundy/iStock.com