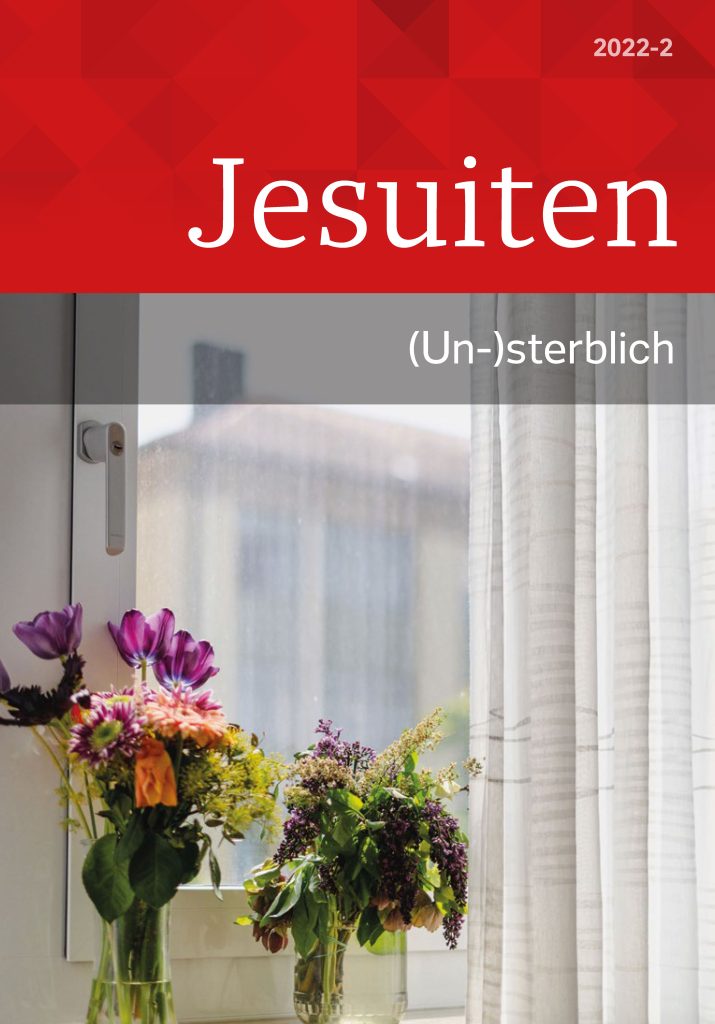Warum eine gesamteuropäische Erinnerungskultur wichtig ist
In Deutschland gilt: der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939. Da überfiel die Wehrmacht Polen. In Russland gilt: Im Juni 1941, als die Wehrmacht die Sowjetunion überfiel. In Polen und Osteuropa hingegen gilt als das entscheidende Datum der 23. August 1939 – vor genau 83 Jahren. Da unterzeichneten die Außenminister Deutschlands und der Sowjetunion in Moskau einen Nichtangriffspakt. Er machte es Hitler möglich, Polen acht Tage später zu überfallen. 16 Tage später marschierte Stalin in den Osten Polens ein.
In der Mitte des Landes trafen sich die beiden Sieger zu einer gemeinsamen Siegesparade. Von 1939 bis 1941 ermordeten Soldaten beider Armeen circa 200.000 Polen. Stalin griff „nebenbei“ auch auf Estland, Lettland und Finnland zu.
Das alles ist in den mittel-osteuropäischen Ländern in lebendiger Erinnerung geblieben. Ich erinnere mich: Im Sommer 1978 trafen wir Jesuiten-Novizen aus Deutschland (West und Ost) uns in Polen. In Krakau hatten wir die Gelegenheit, mit dem damals eher unbekannten oppositionellen Historiker Wladyslaw Bartoschewski zu sprechen. Nach der Wende 1989 wurde er Außenminister Polens. Er erzählte uns damals:
„Ich beginne meine Vorlesung an der fliegenden Universität in Lublin immer mit dem Hinweis, dass der Zweite Weltkrieg nicht von einem schnurrbärtigen, sondern von zwei schnurrbärtigen Herren begonnen wurde.“
Im April 2009 erklärte das Europäische Parlament den 23. August zum „Europäischen Tag des Gedenkens an die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus.“ In Deutschland bleibt eine Scheu, die Parallelisierung dieser beiden Totalitarismen zu sehr zu betonen. Man möchte weder die Singularität des Holocaust in Frage stellen noch die Verbrechen relativieren, die auf den Überfall Hitlers auf die Sowjetunion folgten.
Doch es schwingt in dieser Scheu auch die problematische Vorstellung von der „Nachbarschaft“ zwischen Deutschland und Sowjetunion (beziehungsweise heute: Russland) mit. Sie wirkt wie ein Nachklang europäischer Großmachtpolitik vergangener Jahrhunderte. Die Völker, die zwischen diesen „Nachbarn“ liegen, werden dann gerne übersehen oder als vernachlässigbare Größen eingestuft.
Gemeinsames Erinnern – mit Respekt
Das war fatal, und ist es auch heute. Geopolitisch-imperiales Denken ist daran zu erkennen, dass zwischen „wichtigen“ großen und „weniger wichtigen“ kleineren Völkern unterschieden wird. Die Versuchung, dies zu tun, liegt heute wieder nahe und erklingt auch in Deutschland wieder in manchen Debatten.
Darin liegt aber auch eine Chance, nämlich die, sich die Bedeutung einer gesamteuropäischen Erinnerungskultur neu bewusst zu machen, gerade auch in Deutschland. Dazu gehören Gespür für und gegenseitiger Respekt vor den unterschiedlichen Gedenktagen, die die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und seine Gräuel unterschiedlich prägen.