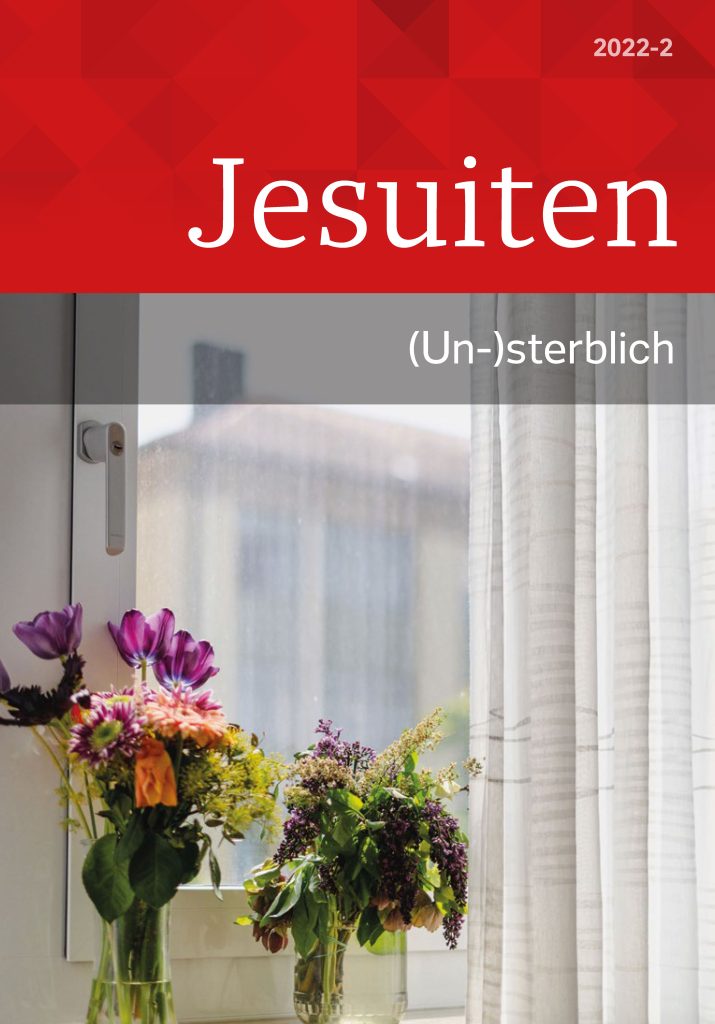Es wird Zeit, dass wir über Bildungsziele reden
Der Sommer ist jung und viele Themen eines langen, dunklen Corona-Winters sind vom Radar verschwunden. Und meistens ist das gut. Wir brauchen das Atemholen. Die Frage ist, wo die Probleme liegen, die nicht weg sind, nur weil wir gerade nicht mehr über sie reden.
Alle Pädagoginnen und Pädagogen, mit denen wir zu tun haben, melden uns zurück: Viele Kinder und Jugendliche sind gezeichnet von der Zeit, die hinter ihnen liegt. Die Folgen von Corona bei ihnen sind vielfältig wie die Lebensverhältnisse: Sie reichen von der Schwierigkeit, sich mit Gleichaltrigen und in der Klasse angemessen zu bewegen, über enormen Nachholbedarf im Lernstand bis hin zu psychischen Belastungen. Gefährdungen, die durch die sozialen Medien befördert werden, haben massiv zugenommen, so z. B. das unangemessene Kontrollverhalten von jungen Menschen im Blick auf ihre Ernährung, also etwa Essstörungen. Wie ernst gemeint war es eigentlich, als fast schon ritualisiert Erwachsene sich selbst und vor allem gegenseitig geißelten, man habe in der Krise der Situation von jungen Menschen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt?
Knappheit der Ressourcen an Schulen und Kitas
Endlich läuft der Schulbetrieb wieder einigermaßen normal. Und damit haben Schülerinnen und Schüler wieder ihren Lebensraum, in dem sie sich mit Gleichaltrigen geschützt bewegen und lernen können. Und lernen meint eben nicht nur den Lernstoff pauken. Schule ist vor allem auch ein geschützter Rahmen für soziales Lernen. Und so wäre die Schule ein privilegierter Ort, um den Kindern und Jugendlichen Hilfestellungen zu geben, um die Folgen von Corona zu bewältigen.
„Wäre“ meint nicht, dass Pädagoginnen und Pädagogen derzeit nicht ihr Bestes geben, um genau das zu ermöglichen. Aber dies bräuchte Raum und Zeit. Und an vielen Schulen und in den Kitas herrscht immer noch dieselbe Notstandsverwaltung wie vor Corona: Knappheit der Ressourcen, vor allem Personalmangel. Vor allem aber ein Betrieb, dominiert von Leistungsmessungen, Abschlüssen und der damit verbundenen Bürokratie. Dass Kitas und Schulen ganz still und leise die Institutionen waren, die in vielen Bundesländern ganz reibungslos auch noch die Integration von Geflüchteten schulterten, ist unter diesen Vorzeichen nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Sie sind gewohnt, weiter funktionieren zu müssen. Aber Raum zur Krisenbewältigung bleibt dabei vermutlich nicht viel.
Von Krise zu Krise
Nicht die Krise war die Katastrophe. Dieses Land hat in vieler Hinsicht Ressourcen wie kaum ein anderes auf der Welt, um Krisen zu stemmen. Und auch für die meisten jungen Menschen wäre die Krise an sich nicht die Katastrophe. Denn an Krisen können wir Menschen wachsen. Die eigentliche Katastrophe in diesem Land ist, dass wir beschlossen haben, elementare Lebensbereiche wie Bildung und Gesundheit schon für den Normalbetrieb knapp am Rande des Minimums auszustatten. Und so schrammen diese Bereiche seit Jahren von Krise zu Krise.
Hin und wieder überkommt uns das schlechte Gewissen: Dann beginnen öffentlicher Applaus, öffentliche Bußrituale und Schuldzuweisungen. Die sind gestrickt wie unsere Fastenvorsätze. Sie halten knapp zwei Wochen. Und dies ist kein Problem von Politikern. Es betrifft uns alle. Denn ein erster Schritt wäre, dass wir uns endlich Zeit nehmen, um gemeinsam darüber ins Gespräch zu kommen, was gute Schulbildung eigentlich ausmacht. Dazu könnten Fragen gehören, wie diese: Muss es in Schule eigentlich nur um den Erwerb von Abschlüssen und Fertigkeiten gehen? Oder wäre es nicht auch ein Auftrag für Schulen, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Jugendliche im Lebensraum Schule Selbstwirksamkeit, den Umgang mit den Folgen von Krisen und Hoffnung, entwickeln?
Bildung jenseits ökonomischer Verzweckung und säkularer Verengung
Einladung zum 4. Salon HumanismusPlus
Am 8. Juni findet ein virtuelles Salongespräch mit FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube zu christlich-humanistischen Bildungsperspektiven in einer vielfältigen modernen Gesellschaft statt. Jürgen Kaube nimmt in seinem Impulsvortrag folgende Leitfrage in den Blick: Wie ist Bildung anzulegen, die sich gegenüber Fremdvereinnahmungen verwahrt und stattdessen auf Subjektkonstitution, Urteilskraft und Weltverständnis zielt – und welche Rolle kann der Religion dabei zukommen?
Die Salonreihe ist ein Leuchtturm-Format der Initiative „HumanismusPlus“.