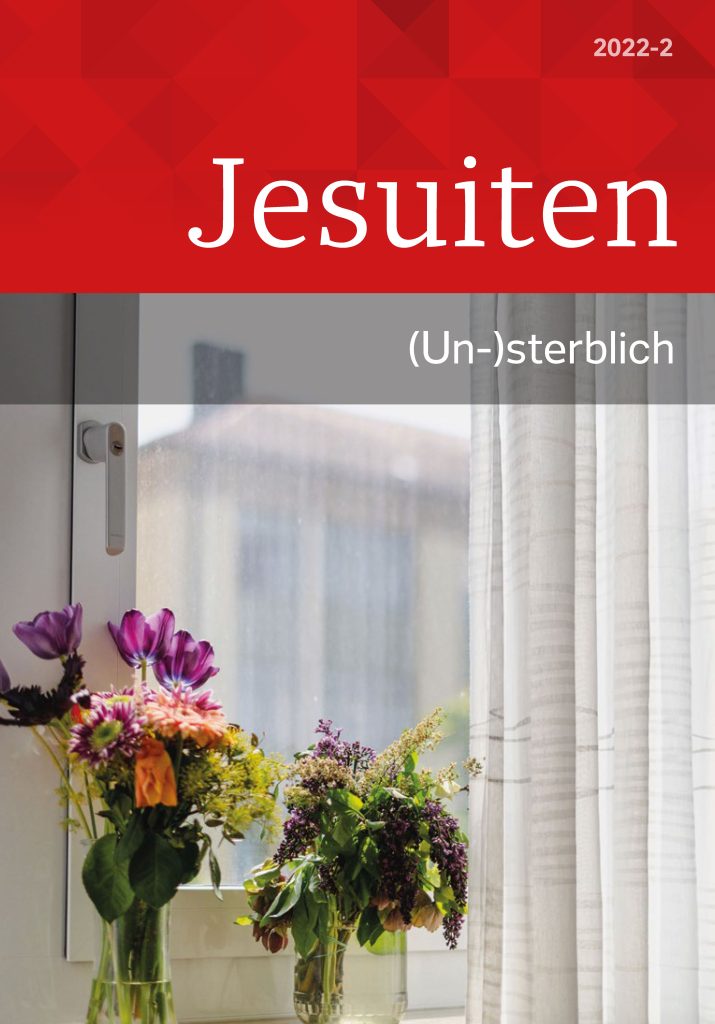Zum Rücktritt von Generalvikar Andreas Sturm
Der Generalvikar Andreas Sturm ist wegen des Ausmaßes der Missbrauchsfälle aus der katholischen Kirche zurückgetreten. Er will in die Altkatholische Kirche eintreten. Trotz der schlechten Nachricht sieht Klaus Mertes auch Positives an seiner Kirche und dem Synodalen Weg und bekennt: „Den geistlichen Hoffnungsblick kriege ich nicht los.“
„Ich habe im Lauf der Jahre Hoffnung und Zuversicht verloren, dass die römisch-katholische Kirche sich wirklich wandeln kann. Gleichzeitig erlebe ich, wie viel Hoffnung in laufende Prozesse wie zum Beispiel den Synodalen Weg gesetzt wird.“ Er sei aber nicht mehr in der Lage, „diese Hoffnung auch zu verkünden und ehrlich und aufrichtig mitzutragen, weil ich sie schlichtweg nicht mehr habe“. Das sagte der Speyerer Generalvikars Andreas Sturm laut KNA-Meldung vor wenigen Tagen über seinen Eintritt in die alt-katholische Kirche.
3 Wege: Austritt, Rückzug, Flucht
Ich erlebe den Verlust der Hoffnung auf Veränderung nicht nur bei Laien, sondern auch bei Klerikern hierzulande. Für Letztere gibt es unterschiedliche Formen, mit Hoffnungsverlust umzugehen. Die eine Form ist eben der Austritt. Die andere ist der Rückzug in den Zynismus, nach dem Motto: „Ich bin innerlich eigentlich auch schon weg, aber ich mache äußerlich noch mit. Die Leute brauchen mich noch irgendwie.“
Viele Gläubige spüren diese Ambivalenz bei „Hirten“. Ihr ausgesetzt zu sein hinterlässt eine Grundstimmung der Traurigkeit, eine Vorbotin gerechten Zorns. Andere Amtsträger fliehen in reaktionäre Zirkel. Diese verbreiten allerdings auch eher wenig Hoffnung; sie zeichnen sich meist dadurch aus, dass sie viel schimpfen. Dauerschimpfen hinterlässt wenig Freude. Und schließlich gibt es jene, die auf Reformen setzen, konkret also: Auf den Synodalen Weg, und dabei mitmachen.
Machen sich diejenigen Amtsträger, die beim Synodalen Weg mitmachen, für illusionäre Hoffnungen bei den Leuten mitverantwortlich? So lese ich die Erklärung des ehemaligen Speyrer Generalvikars nicht, dafür aber eher schon das kürzlich erschiene Buch des emeritierten Bonner Kirchenrechtlers Norbert Lüdecke (Die Täuschung. Haben Katholiken die Kirche, die sie verdienen? Streitschrift zur Zwischenbilanz des Synodalen Wegs). Der hat auch alle Hoffnung auf Reformierbarkeit des Systems verloren. Aber er macht denjenigen Hirten, die auf Reform setzen, den Vorwurf, die Leute hinters Licht zu führen. Die Amtsträger, so der Gedanke, müssten es besser wissen: Das System sei nicht reformierbar; aber sie sprächen es nicht aus; stattdessen machten sie den Leuten Hoffnungen, die sie selbst nicht hätten – oder redeten sie sich selbst ein. Hmm. Ich finde, da nimmt einer den Mund zu voll.
Synodaler Weg: ein Anstoß zu einer größeren Reform
Auch mir wurde im Herbst 2018 angst und bange, als die Bischofskonferenz (DBK) und das Zentralkomitee (ZdK) den Synodalen Weg einberiefen, nicht zuletzt auch wegen der Hoffnungen, die dadurch bei vielen engagierten Katholikinnen und Katholiken geweckt werden würden. Ich mache mir auch Sorgen um geschätzte Mitkatholikinnen und -katholiken, deren Hoffnung auf einem Abgrund von Verzweiflung glüht und schnell verglühen könnte: „Entweder der Synodale Weg gelingt, oder ich trete aus.“ Es ist ja klar, dass der Synodale Weg nur einen Anstoß geben kann zu einer gesamtkirchlichen Reform, wie immer sie am Ende aussehen wird, einer Reform, die erst auf einem Dritten Vatikanischen Konzil beraten und entschieden werden kann. Man kann zwar vor Ort schon in einigen Dingen voranschreiten, aber für das Ganze wird es noch dauern.
Aber: Sind das Argumente gegen die Hoffnung auf Veränderung? Nein. Veränderungen von großen Systemen beginnen immer unten, nicht oben. Sie sind immer von Konflikten begleitet; das kann gerade in einer global agierenden und lebenden Institution wie der katholischen Kirche gar nicht anders sein. Es gibt auch keinen Grund, die Köpfe in den Sand zu stecken, wenn nordische und andere Bischofskonferenzen die Augenbrauen runzeln über den Synodalen Weg. Vielmehr sind das erste Erfolgsmeldungen.
Die Themen, um die es auf dem Synodalen Weg geht, sind keineswegs nur deutsche oder „westliche“ Themen. Der Anlass, sich ihnen mit neuer Dringlichkeit zu stellen – der Missbrauch – ist es auch nicht.
Und schließlich: Wir sind Kirche. Da darf vielleicht doch auch Gott als der Herr der Geschichte noch eine Rolle spielen.
Das Leben wird bekanntlich vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ich setze darauf, dass sich eines Tages rückblickend Sinnerkenntnisse vor unseren Blicken entschlüsseln werden, die wir jetzt noch nicht erkennen. In ihnen werden sich die Spuren des mitgehenden Auferstandenen zeigen, den wir jetzt noch nicht mitgehen sehen. Das gilt im Übrigen auch für meinen Blick auf die Geschichte der Menschheit. Aktuell bietet sie ja auch nicht so viel Anlass zur Hoffnung. Und trotzdem: Den geistlichen Hoffnungsblick kriege ich nicht los. Ich nehme ihn an. Ich verdanke ihn dem Evangelium. Und das Evangelium verdanke ich wiederum der Kirche. Ich bleibe.