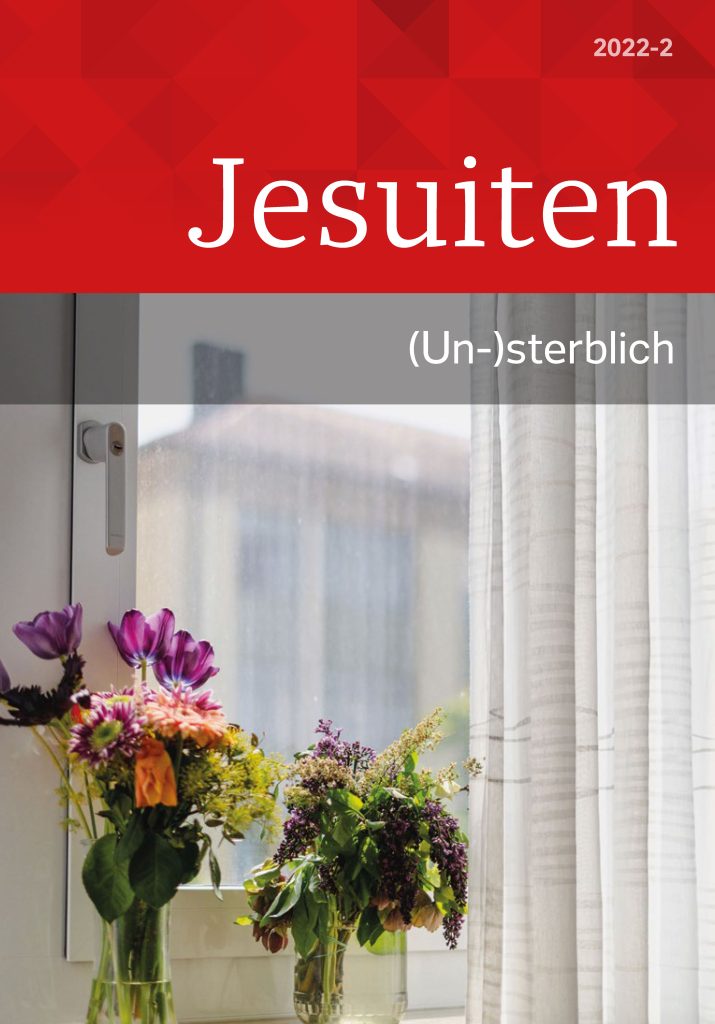Gedankenanstöße zur Klimakatastrophe
Spätestens seit der UN-Klimakonferenz von Paris im Jahr 2015 sind die wesentlichen Faktoren der Klimakatastrophe bekannt: Wenn es nicht gelingt, die Treibhausgasemissionen innerhalb eines definierten Zeitraumes auf praktisch null abzusenken, wird es zu unkalkulierbaren irreversiblen Veränderung des Klimas kommen, die mittel- und langfristig das Potenzial haben, das Leben auf dem Planeten weitgehend zu zerstören. Das Problem dabei: Je länger die Menschheit zögert, desto radikaler und schneller muss die Absenkung erfolgen und desto unwahrscheinlicher wird der Erfolg des Unternehmens.
In der Corona-Pandemie ließ sich eine atmosphärische Veränderung wahrnehmen. Es zeigte sich, wie kurzfristig weitreichende Maßnahmen auch gegen den ansonsten so unantastbaren Vorrang der Ökonomie durchgesetzt werden konnten, weil höhere Güter in Gefahr waren. Zudem wurde laut darüber nachgedacht, dass das erzwungene „Innehalten“ genutzt werden könnte, um grundsätzliche Fragen nach den Grenzen der Mobilitäts- und Konsumgesellschaft zu stellen.
Doch schon in der Phase der sommerlichen Niedrig-Inzidenz 2021 war davon kaum mehr etwas zu spüren. Mit dem Ukrainekrieg rückte im Winter 2022 schließlich ein weiteres Bedrohungsszenario ins Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit, sodass es kaum noch auffiel, als die Internationale Energieagentur (IEA) am 8. März 2022 bekannt gab, dass 2021 mehr Treibhausgase emittiert wurden als jemals zuvor. Das Wachstum in 2021 überwog sogar den pandemiebedingten Rückgang des Vorjahres.
Pfadänderung
Wir stellen also fest: Für das Einhalten der Pariser Klimaziele wird es ziemlich knapp. Extrem knapp. Genaugenommen spricht nichts dafür, dass wir sie erreichen. Es sei denn … und an dieser Stelle verlassen wir – nur mal probehalber – den üblichen Pfad der dramatischen Appelle und der “fünf Minuten vor zwölf”-Rhetorik und nehmen einen anderen Pfad.
Wie wäre es, wenn wir das Scheitern akzeptieren? Wir werden die Klimaziele nicht erreichen!
Das bedeutet, dass sich unsere Lebensbedingungen in globalem Maßstab innerhalb von ein paar Jahrzehnten derart verschlechtern könnten, wie wir uns das noch nicht vorstellen können. Ein Zusammenbruch komplexer Gesellschaften rückt damit in den Bereich des Hochwahrscheinlichen.
So vorgetragen hat das der Philosoph Rupert Read. Er hält den „grundsätzlichen und endgültigen Zusammenbruch der Zivilisation“ in der Folge der klimatischen Instabilität für das wahrscheinlichste Zukunftsszenario. Ähnlich auch der Romancier und Essayist Jonathan Franzen: Aus seiner Sicht verstellt das Festhalten an nicht erreichbaren Zielen den Blick auf diejenigen, die es sind.
Ebenso der Geograf Jem Bendell in seinem vielbeachteten Papier „Deep Adaptation“: Er geht davon aus, dass – selbst wenn wir die Unaufhaltsamkeit der Klimakatastrophe akzeptieren – die daraus resultierenden gesellschaftlichen Herausforderungen so groß sein werden, dass wir es uns nicht leisten können, sie einfach auf uns zukommen zu lassen. Wir müssen also lernen, mit dem kollektiven Niedergang zu leben – technisch wie kulturell.

Verlust der Motivation?
Aber verlieren wir mit der Akzeptanz des Scheiterns nicht den Hauptmotivator dafür, uns gegen die Klimakatastrophe zu stellen? Folgt daraus nicht bloße Resignation? Tatsächlich macht es einen großen Unterschied, ob wir die Klimaziele um wenige Zehntel eines Grades oder um ein paar Grad verfehlen. „Akzeptanz“ ist aber nicht zu verwechseln mit „Aufgabe“. Für diejenigen, die die Klimakatastrophe leugnen, ignorieren oder kleinreden wird es nichts ändern, wenn ein Teil der Menschen das Scheitern akzeptiert.
Diejenigen, die die Klimakatastrophe jetzt schon ernst nehmen und tiefgreifende Veränderungen ihres Lebens vornehmen, einen konsum- und mobilitätsreduzierten Lebensstil pflegen, werden deswegen davon nicht abrücken. Und diejenigen, die tendenziell von der Notwendigkeit einer fundamentalen Kurskorrektur überzeugt sind, es aus verschiedenen Gründen noch nicht geschafft haben, diese für sich zu vollziehen, werden deshalb auch nicht zwangsläufig in einen Konsum- und Mobilitätsrausch verfallen.
Was aber gewinnen wir durch die Akzeptanz des Unvermeidlichen?
Zunächst gewinnen wir Authentizität. Wir treten heraus aus der selbstverschuldeten Realitätsverkennung und befreien uns von der immer stärker werdenden Frustration der kollektiven Unwirksamkeit – natürlich zunächst um den Preis eines Realitätsschocks. In der Folge gewinnen wir jedoch neue Handlungsspielräume: Wie wollen wir nun leben in der verbleibenden Zeit? Was wollen wir fortsetzen und was macht jetzt keinen Sinn mehr?
Palliative gesellschaftliche Situation?
In der Medizin gibt es einen kurativen und einen palliativen Zweig. Die kurative Medizin ist auf Heilung ausgerichtet, auf das Wiederherstellen der völligen Gesundheit, während die palliative Medizin akzeptiert, dass Heilung im engeren Sinn nicht mehr möglich ist. Natürlich wird zunächst immer ein kurativer Ansatz verfolgt. Aber es gibt eben Fälle, in denen kurative Ansätze nicht mehr realisierbar sind.
In solchen Fällen ist der Prozess, sich darüber klar zu werden, außerordentlich schwer und schmerzhaft. Und nicht selten führt das Festhalten an einem nicht erreichbaren Ziel zu zusätzlichen Belastungen für den Patienten. Demgegenüber wird das Anerkennen des Unvermeidlichen bei aller Tragik häufig als Befreiung erfahren. Die verbleibende Zeit kann dann bewusst gestaltet und gelebt werden. Sind wir also in einer palliativen gesellschaftlichen Situation? Zugegeben, es ist nur ein Vergleich – und Vergleiche hinken bekanntlich zuweilen. Aber selbst hinkende Vergleiche können uns etwas zeigen. Sie ermöglichen uns einen Blick auf die Realität aus einer anderen Perspektive. Und vielleicht ist genau das jetzt notwendig.
Illustrationen: © tommy/iStock.com, © sesame/iStock.com