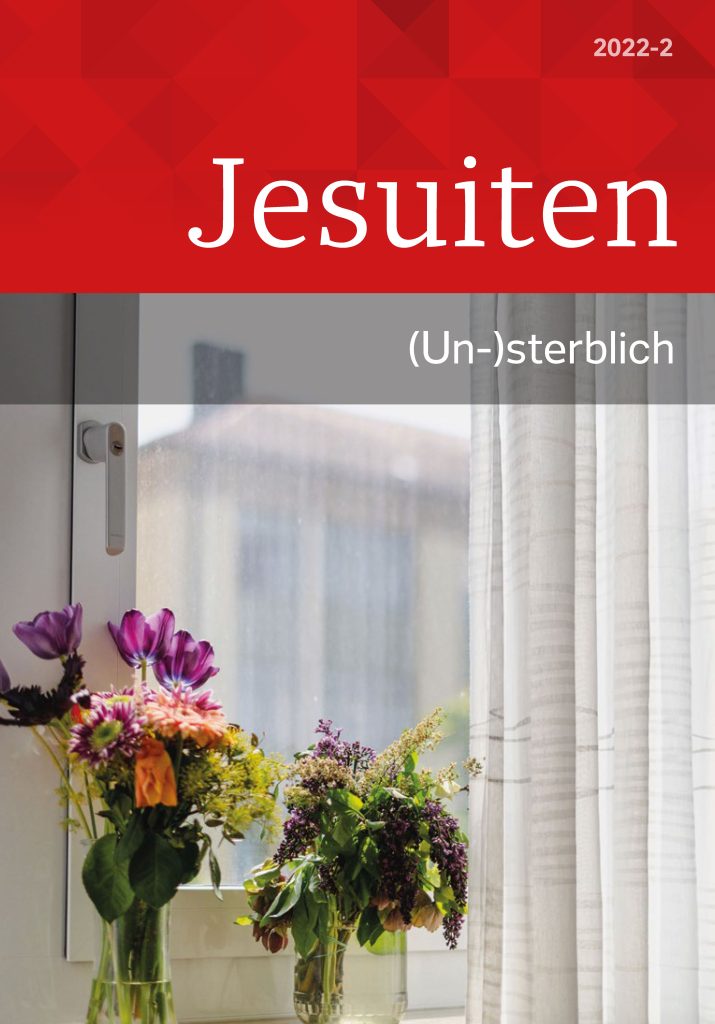Wie Menschen mit Behinderung die Corona-Zeit erleben
Wie lebt es sich derzeit in einem Wohnhaus für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung? Wie gehen die Bewohner*innen mit der neuen Lebenswirklichkeit um? Wie blicken sie auf die Corona-Krise? Was fehlt am meisten? Was wird dazugelernt? Und was können wir von ihren Blickwinkeln lernen? Ein kleiner, nicht umfassender Einblick in das Corona-Zeit-Erleben in einem Wohnhaus für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in Freiburg.
Emotionale Achterbahnfahrt
Die Zeiten sind gemischt. „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, beschreibt die Stimmungslage in unserem Wohnhaus nach unserem Empfinden seit nun gut über einem Jahr recht treffend. Die Bewohner*innen und wir Mitarbeiter*innen machen ein Wechselbad der Gefühle durch – eine emotionale Achterbahnfahrt, immer wieder. Gefühle wie Frustration, Traurigkeit, Angst, Glück und Zuversicht wechseln sich stetig ab. Auch wir sehnen uns nach der alten Normalität.
Es ist seit einem Jahr ein permanentes Ausloten: Was geht? Was geht nicht? Für die Wohngemeinschaften, für die Bewohner*innen, für die Mitarbeiter*innen.
Viele, viele schwammige Diskussionen und eine Flut an Informationen haben wir durchlebt. Leben und Arbeiten sind insgesamt anstrengender geworden. Sicherheiten durch Strukturen und Routinen sind weggebrochen. Kaum bauen wir neue auf, kommt eine neue Verordnung. Damit fallen die gerade etablierten Strukturen und Sicherheiten wieder weg. Dann suchen wir wieder: Wie kann es weitergehen? Was gibt Orientierung? Was ist machbar? Was ist für die Bewohner*innen und deren Umfeld noch lebbar? Mit welchem Recht können wir die Freiheiten einschränken? Wie machen wir das den Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen und Angehörigen verständlich?
Wir haben hier viel über Kommunikation gelernt, mit dem Fazit:
Viel zu kommunizieren ist nicht immer zielführend, sondern zum richtigen Zeitpunkt klar zu kommunizieren.

Miteinander und aneinander gewachsen
Viele unserer Kolleg*innen würden unterstreichen: Wir haben viel Neues, viel Verunsicherndes und viele Herausforderungen erlebt, doch wir sind aneinander und miteinander gewachsen. Wir haben das Zusammenwirken, wenn etwas gut geklappt hat, als großes, innerliches Glück empfunden. Natürlich bleibt der Wunsch, dass bald alles wieder einfacher wird – und mit Blick auf die bereits hinter uns liegenden Impfungen beschleicht uns immer wieder das Gefühl der Zuversicht.
Die Bewohner*innen leiden wie alle Menschen darunter, dass ihre Freiheiten, ihre selbstgestalteten Routinen und ihr Alltag nicht mehr in gewohnter Weise möglich sind. Besonders Menschen mit Behinderung sind auf routinierte Abläufe angewiesen, da sie ihnen Orientierung und Sicherheit bieten. Auch andere grundlegende Bedürfnisse, wie Nähe, Kuscheln und Berührungen, sind in Frage gestellt worden, sind nicht mehr wie gewohnt erfahrbar. Dabei ist zu betonen, dass viele Menschen mit Behinderung körpernahe Kommunikationsformen benötigen, um mit ihrer Umwelt in Kontakt zu treten. Die Folgen dieser Situation sind noch nicht absehbar.
Rückschritte bei Teilhabe und Teilgabe
Auch Inklusionsprozesse stagnieren. „Abschotten“ als gesetzlich vorgeschriebene Schutz-Strategie berührt auch die Teilhabe und Teilgabe. Die Bewohner*innen sind seit gut einem Jahr kaum mehr sichtbar im Gemeinwesen. Sie gehen in die Natur, haben aber deutlich weniger Kontakte aus dem Haus heraus, wie das hier ansonsten üblich ist. Es sind viele Dinge weggebrochen, die normalerweise zu unserem Haus-Leben gehören: ehrenamtliches Engagement, Besuche von Freizeitclubs, Vereinsaktivitäten, Ausflüge, Einkäufe …
In diesem Zusammenhang muss deutlich gesagt werden, dass die Teilhabe am Leben im Sozialraum für Menschen mit Behinderung auch vor der Pandemie noch immer keine Selbstverständlichkeit war.
Im Freiburger Stadtteil Haslach hat viel Engagement von verschiedenen Akteur*innen dazu geführt, dass unsere Bewohner*innen und unser Haus dazugehören. Umso schmerzlicher wird dieser Rückschritt empfunden. Aber wir erfahren auch Zeichen des Nicht-Vergessen-Werdens, wie etwa Musiker*innen, die vom Garten aus ihre Instrumente für uns zum Klingen bringen oder ein Eiswagen, der auf unserem Hof Halt macht.

Das Hier und Jetzt zählt
Die Bewohner*innen zeigen, wie in vielen Krisensituationen, über welche Anpassungsfähigkeit und inneren Bewältigungsressourcen sie verfügen. Sie arrangieren sich mit der neuen Lebenswirklichkeit, mit all den Einschränkungen und Veränderungen, die doch etwas heftiger und deutlicher von außen bestimmt werden, wie die derer, die ohne Behinderung, nicht in einer stationären Einrichtung leben. Wenn einer von zwölf Bewohnern einen „Schnupfen“ hat, bedeutet es zum Beispiel, dass die ganze Wohngruppe in Quarantäne muss.
In der Begleitung der Bewohner*innen wird uns immer wieder deutlich: Die Angst vor dem Virus wird nicht so stark erlebt. Wir erleben weniger Befürchtungen, weniger Hadern und weniger Frustration. Wir erleben mehr Hoffnung, Vertrauen und die Gewissheit: „Alles wird gut werden, so wie es kommen wird.“ Unsere Bewohner*innen zeigen uns, dass derzeit, vielleicht das immer Wesentlichste im Leben, das im Hier und Jetzt sein, zählt. Oft kommt das, was uns belastet, eher aus dem Gestern und dem Morgen, der Vergangenheit und der Zukunft. Der jetzige Augenblick, hier draußen auf der Bank, in der Sonne, mit Kaffee und Kuchen, mit netten, zugewandten Menschen, geht darin verloren.
Vielleicht könnten auch wir uns in diesem Zeit-Erleben üben? Vielleicht können uns und Sie, die Bewohner*innen darin bestärken?
Wesentlich ist die menschliche Begegnung
Diese Zeiten zwingen uns alle zu grundlegenden, noch vor wenigen Monaten unvorstellbaren Veränderungen, die entgegen unseren gewohnten Routinen, unserer Hauskultur und den Grundfesten der Behindertenhilfe gehen.
Aber auch da sind uns die Bewohner*innen ein Vorbild: Sie haben es fest im Blick. Sie lassen sich nicht unterkriegen! Das wirklich Wesentliche – nämlich die menschliche Begegnung – wird nicht aus dem Blick verloren.
Fotos: © Patty1971/photocase.com, © daaarta/photocase.com, © akai/photocase.com