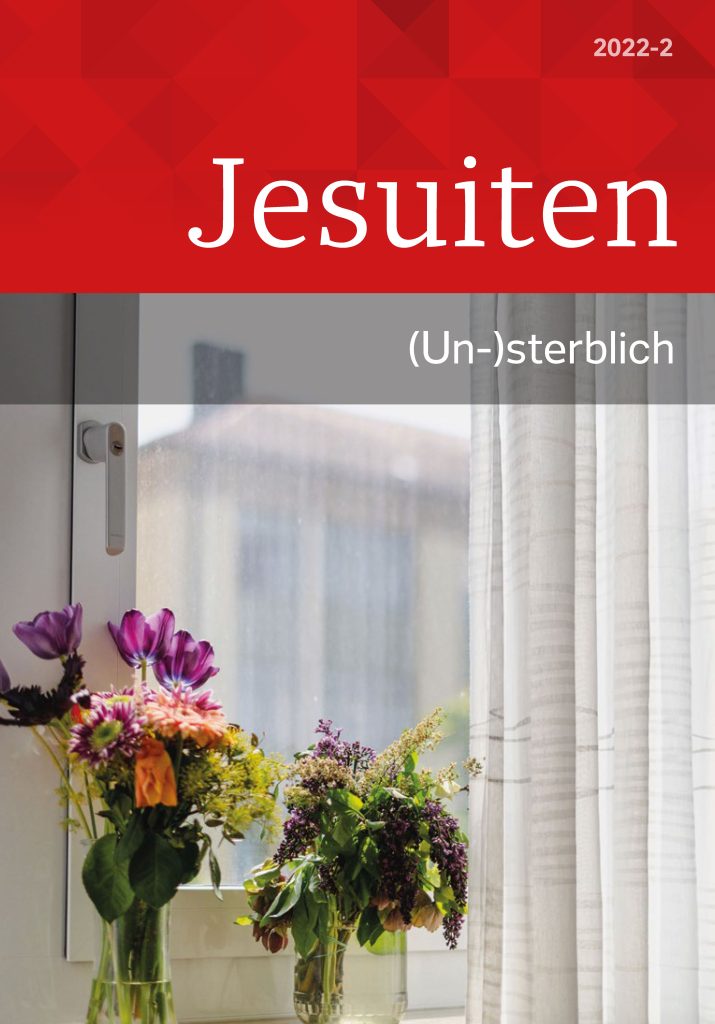Ergebnisse einer Umfrage zur Persönlichkeitsbildung an Schulen
Fragt man heute, was Kinder und Jugendliche in der Schule unbedingt lernen sollen, ist die meistgenannte Antwort: „Gute Beherrschung von Rechtschreibung und Grammatik“. Echt jetzt? Immer noch? Ja, tatsächlich. 77 Prozent der Befragten haben dieses Lernziel als besonders wichtig eingestuft. Gefolgt übrigens von den Zielen Allgemeinbildung (76 Prozent), Fähigkeit, erlerntes Wissen auch anzuwenden (69 Prozent) und Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit (56 Prozent).
Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, die das Ludwigshafener Heinrich Pesch Haus im Herbst 2019 in Auftrag gab. Das Institut für Demoskopie Allensbach befragte Bürger nach ihrer Einstellung zu Kindererziehung und den Aufgaben von Schulen. Es sollte festgestellt werden, inwieweit die Prinzipien der ignatianischen Pädagogik auf Zustimmung bei der Bevölkerung stoßen. Die ignatianische Pädagogik geht davon aus, dass die Schule nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch zur Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler beitragen soll. Nicht für die Schule, sondern für das Leben …
Persönlichkeitsbildung zentrale Aufgabe der Schulen
Eine Mehrheit der Befragten hielt außerdem Teamfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, gute Mathematikkenntnisse und kritisches Denken für besonders wichtig. „Man erkennt in den Ergebnissen keine eindeutige Hierarchie zwischen Bildungs- und Erziehungszielen“, ordnet Dr. Thomas Petersen vom Institut für Demoskopie Allensbach die Ergebnisse ein.
Soziale Kompetenzen wie Pünktlichkeit, Hilfsbereitschaft und Höflichkeit, allgemeine Fähigkeiten wie Konzentrationsfähigkeit, Selbstbewusstsein und Teamfähigkeit sowie klassische Bildungsziele die Rechtschreibung und Mathematikkenntnisse stehen in der Rangfolge nebeneinander.
„Auch die Antworten auf andere Fragen der Studie zeigen deutlich, dass viele Bürgerinnen und Bürger die Persönlichkeitsbildung als eine zentrale Aufgabe der Schulen ansehen.“ Thomas Petersen
Damit zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass die Bildungsziele der ignatianischen Pädagogik durchaus auf großen Zuspruch bei der Bevölkerung stoßen und als praktisch gleichrangig mit traditionellen Bildungszielen angesehen werden. „Zwar sind ihre religiösen Motive großteils verdampft, doch bleiben sie in säkularisierter Form präsent“, so Petersen. In der wichtigen Zielgruppe der Katholiken und Personen mit höherer Schulbildung bestehe weiterhin ein deutlich überdurchschnittliches Interesse daran, Kinder zur Aufgeschlossenheit gegenüber religiösen und Sinnfragen des Lebens zu erziehen.
Klassische Lerninhalte sind überbetont
„Aufschlussreich ist es nun, die Frage nach den Erwartungen an die Schulen mit den Urteilen über deren tatsächliche Stärken und Schwächen zu vergleichen“, sagt Petersen. Hier sehen die Befragten Defizite vor allem bei Punkten, die im Fokus der ignatianischen Pädagogik stehen: Erziehung zum Selbstbewusstsein, zum kritischen Denken, zur Konzentrationsfähigkeit und zur Fähigkeit, erlerntes Wissen auch anzuwenden.
Umgekehrt sahen die Befragten an den Schulen eher eine Überbetonung klassischer Lerninhalte. Dabei legen Trenddaten aus dem Archiv des Instituts für Demoskopie Allensbach die Vermutung nahe, dass das Gefühl, wonach an den Schulen die Persönlichkeitsbildung zugunsten klassischer Lerninhalte in den Hintergrund gerät, in den letzten zwei Jahrzehnten eher zu- als abgenommen hat.
Die Allensbach-Studie wurde am 9. November 2020 anlässlich des Kampagnenstarts von HumanismusPlus“ zur Stärkung der Persönlichkeitsbildung in den Schulen vorgestellt.
Hier finden Sie die zentralen Ergebnisse der Allensbachumfrage. Ein Ländervergleich mit Großbritannien, der Teil der Studie war, wird Thema einer eigenen Veranstaltung sein. Dazu werden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren.
„HumanismusPlus“ ist eine Initiative des Zentrums für Ignatianische Pädagogik, einem Fortbildungszentrum für Pädagogik in jesuitischer Tradition. Die Kampagne setzt sich für umfassende Persönlichkeitsbildung ein.