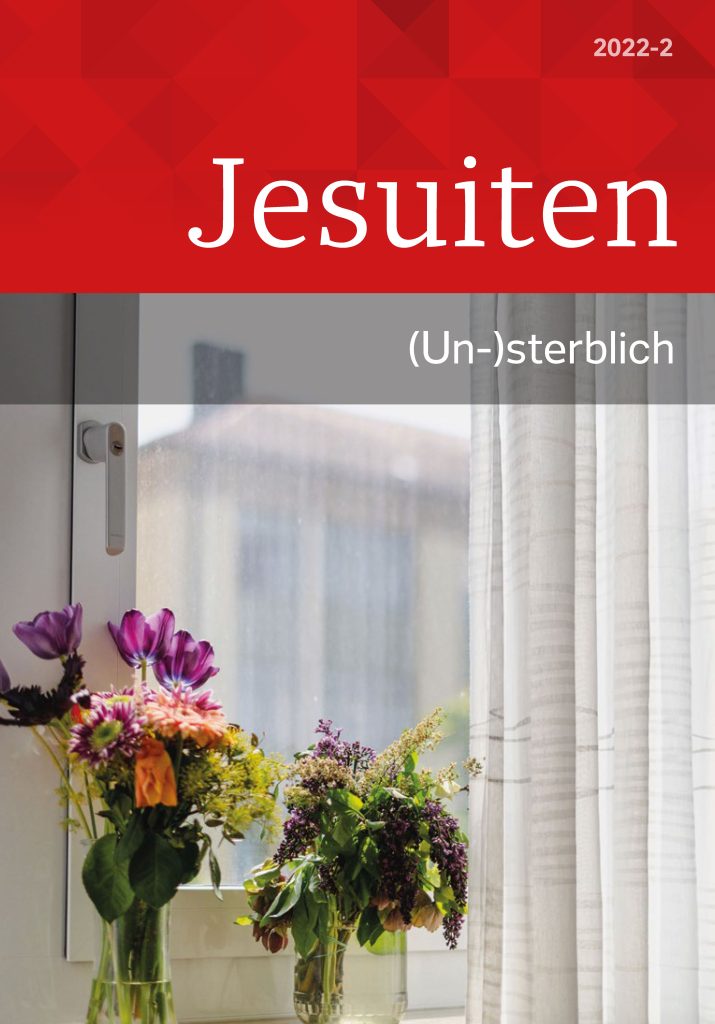Wenn Theologie und Pastoral der Macht und nicht den Menschen dienen
Der Mensch wandelt sich im Laufe seines Lebens und damit auch die Fragen, die er sich stellt. Andreas Heek beschreibt im ersten Teil seines Beitrags, wie die Kirche sich selbst und einer echten Beziehung zu Gott im Weg steht.
Am Anfang, spätestens nach dem Ende der Kindheit, ist das Unbehagen. Eine merkwürdige Fremdheit mit sich selbst und mit anderen spüren viele, die an der Schwelle zum Erwachsenwerden stehen. Es wird klar, Menschen sind keine konsistenten Wesen, kein in Stein gemeißeltes Endprodukt. Sie fließen in die Zeit hinein, ohne den Anfang und das Ende zu kennen.
Gern wäre der Mensch fest und klar, sich seiner selbst stets sicher. Aber er stellt fest: Er befindet sich eigentlich immer lediglich auf einer Zwischenstation zu, ja zu was? Zu sich selbst? Zu seiner Identität? Manchmal zweifelnd, manchmal sicherer ist er hingegen vor allem: unterwegs. Aber nie da, nie fertig.
Wie befreiend scheint da zunächst die Mitteilung der jüdisch-christlichen Religion zu sein. Im Ersten Testament wird Gott vorgestellt als „Ich-bin-da-für-euch“. Darin enthalten: das Identitäre („ich bin“) und das Empathisch-fluide („da für euch“). Allerdings gibt es bei der Begegnung Moses mit diesem Gott auch die verstörende Existenz eines Feuers, das brennt und darin nichts verbrennt. Wärme, die ausstrahlt durch das Feuer, an dem man sich aber, kommt man ihm zu nahe, auch verbrennen kann.
Gottes merkwürdige Fremdheit
Im Neuen Testament spricht Jesus von Abba, seinem „Paps“. Doch die Intimität trügt: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?!“ (Mt 27,46) schreit Jesus verzweifelt sterbend am Kreuz. Selbst zwischen der brutal-patriarchalen Gotteserfahrung Hiobs und der „Stimme verschwebenden Schweigens“ (1 Kön 19,12) gibt es
eine Gemeinsamkeit: Gottes merkwürdige Fremdheit. Eine Nähe, die, will man dort verweilen, nicht gänzlich erfüllt, sondern schnell schwindet. Diese Gotteserfahrung ist wie ein Spiegel der Selbst-Erfahrung: vertraut und fremd zugleich.
Die christliche Mystik kennt einen Ausweg, um aus der Zwiespältigkeit dieser heuristischen Konfusion herauszukommen: Die Kenose, das Leerwerden von allem, was festhält am Identitären, um dadurch ganz und gar offen zu werden für eine ganz neue Erfahrung, für eine neue Wirklichkeit. Paulus deutet die Existenzweise Jesu als Kenose (Phil. 2,6ff.), als „Entäußerung“. In seiner Lesart verzichtet Jesus auf alle göttlichen Attribute und Privilegien, um ganz und gar solidarisch zu werden mit der menschlichen Existenz. Doch hier entsteht erneut eine Verstörung: Verzichtet ein Gottes-Spross auf seine Insignien, verliert er damit keineswegs seine Zugehörigkeit zum „Königshof Gottes“. Jesu Entäußerung ist vorläufig. Nach dem Glaubenszeugnis von Paulus und der Kirche (letztere hat darauf immer besonderen Wert gelegt) hat Jesus die Gotteszugehörigkeit mindestens dann wieder vollständig angenommen, als er, zwar durch die Hölle des Kreuzestodes hindurch, auferstand und heimkehrte in den „göttlichen Palast“, den Himmel.
Die „Normalsterblichen“ müssen sich hingegen mit der vagen Hoffnung auf eine „Auferstehung am jüngsten Tag“ – und nach dem „jüngsten Gericht“ – begnügen. Der Trost auf die Auferstehung bleibt ambivalent, was für die Kirche den Vorteil hat, dass sie dadurch hegemoniale Macht auf die Seelen der Gläubigen ausüben kann.
Die Menschen können hingegen dem Unbehagen ihrer Existenz nicht entkommen, ob sie nun „gläubig“ sind oder nicht. Sie sind vulnerabel auf Schritt und Tritt. Alles ist ungewiss und der Ausgang unklar.

Gefährliche Nähe
In diese verstörenden Realitäten menschlichen Unbehagens ist die christliche Glaubenslehre hineingewachsen wie ein Rhizom. Sie streckte immer mehr Wurzeln aus in die Seelen der Menschen, mal angenehm grünend tröstlich, mal ungehemmt bedrohlich wuchernd. Die Lehre der Kirche verschaffte sich damit eine Hegemonie in der Seelenlandschaft des Menschen. Drohung und Tröstung, Schüren von Angst und Beruhigung wechselten einander ab. Manchmal hinterließ sie den Eindruck, als läge in dieser Gegensätzlichkeit, in ihrer Unberechenbarkeit sogar ihr Lebenselixier.
Den Menschen abhängig zu halten, weil sich seine Identität stets wandelt, war und ist leider immer noch ein Grundmuster kirchlichen Handelns, ihre pastorale Machtbasis sozusagen.
Maßstab dafür ist nicht die unveräußerliche Menschenwürde und die goldene Regel. Ein umfassender Anspruch an den Menschen geht bis tief ins Private des Menschen hinein. Anstatt das Höchstpersönliche vor jeglichem Zugriff zu schützen, will die Kirche als Lehrende überall mitreden. Geburtenkontrolle? Auf keinen Fall. Vorehelicher Geschlechtsverkehr? Vom Teufel. Trennung und Wiederheirat? Gott bewahre. Homosexuelle Liebe? Kann es nicht geben. Die Liste ist lang. Dabei wird nach dem pastoral genannten II. Vatikanischen Konzil das Exkludierende oftmals nicht mehr immer direkt ausgesprochen, wird im Vagen gehalten, manchmal mit poetischen Worten ummantelt. Aber die grundsätzliche Haltung der Allzuständigkeit in menschlichen Angelegenheiten ist erhalten geblieben.
Dadurch entsteht eine gefährliche Nähe. Sie suggeriert dem, der Nähe zulässt, meist weil er
verletzt ist oder sich zeitweilig schwach fühlt, er oder sie sei als Person gemeint. In einer vermeintlichen Haltung von Fürsorge gibt es Ratschläge zu einem „gottgefälligen“ Leben und vor allem, wovon man sich auf jeden Fall fernhalten muss, wenn … Ja was ist, wenn ein Befolgen der „gutgemeinten“ Ratschläge ausbleibt? Nur wenn man sich an alle Gebote und Verbote hält, kann man, so das uneinlösbare Versprechen, frei werden von der unsicheren Existenzweise als Mensch und in den Himmel kommen.
Die Wenn-Dann-Dynamik ist eine gefährliche Nähe, ist geistliche Übergriffigkeit. Echte Empathie sieht anders aus: sie lässt den Ausgang offen, ist Einfühlen in den anderen. Die Haltung einer manipulativen Schein-Nähe meint nicht den schützenswerten, vulnerablen Menschen selbst, sondern eher die Ideale des Theologiegebäudes. Dann schlägt die vermeintliche Wärme oft um in eine Gefühlskälte, die den Menschen aus dem Blick geraten lässt.
Die größte Leistung des Menschen
Die Wahrheit aber scheint zu sein: Niemand kann das Rätsel, vor dem menschliches Bewusstsein steht, wirklich lösen.
Die größte Leistung des Menschen sind nicht all die Erfindungen seines Geistes, die das Leben angenehm und physisch ungefährlich machen, sondern seine Fähigkeit, dem Bewusstsein um sich selbst standzuhalten.
Seltsamerweise scheinen viele bestellte und „berufene“ Menschen in der Kirche mehr als mancher „Nichtgläubige“ genau daran zu scheitern, diese Realität auszuhalten.
Vielmehr werden die Fragen nach Sinn und Ziel des Lebens fast zwanghaft zum Thema gemacht. In vielen Predigten und Katechesen kommen sie vor. Jedoch: Schon das Stellen der Frage nach dem Sinn der Existenz suggeriert eine Antwort. Doch ist die Frage viel zu groß gestellt, als dass sie beantwortbar wäre. Konkreter, weil realistischer ist hingegen die Frage: „Wie willst du leben?“ – mit Betonung auf dem Du! Diese Frage in aller Offenheit zu stellen, die der menschlichen Freiheit gebührt, ist die eigentliche Herausforderung für die Theologie, die damit allerdings auf ein erhebliches Machtpotenzial verzichtet.
Erfahren Sie mehr über die Nähe der Kirche zu den Menschen im zweiten Teil am 22. Juni. Dann werden wir auch den Link unten freischalten.
Fotos: © Headerbild: rehvolution/photocase.com und sophiaa-f/photocase.com