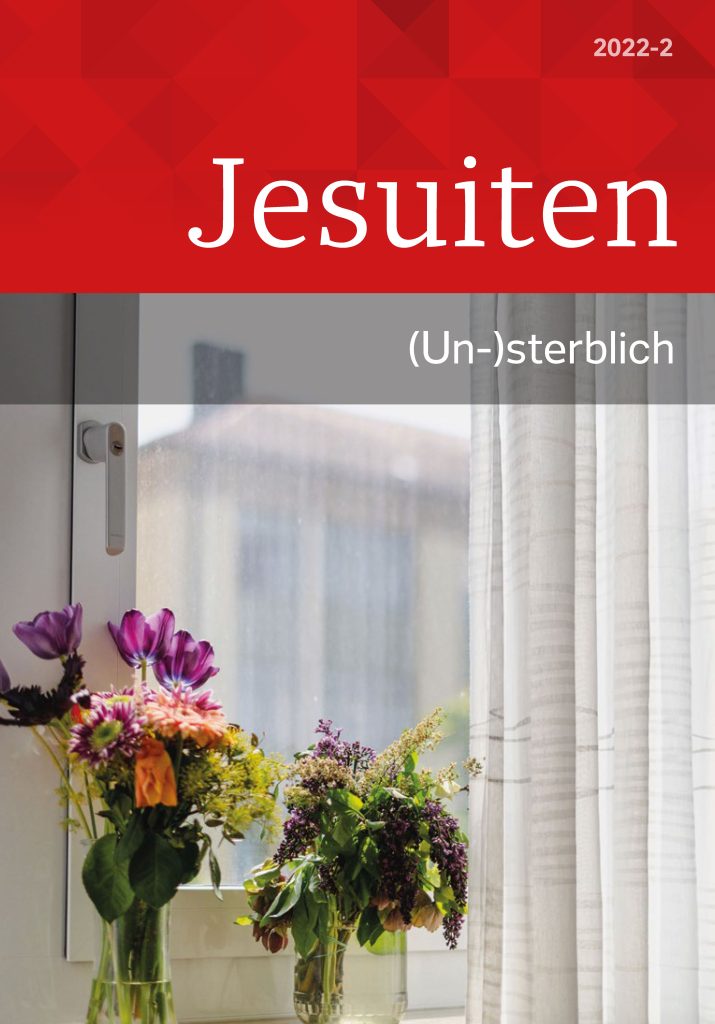Der Gott väterlicher Konsequenz wie mütterlichen Erbarmens
Eins allerdings vorweg: Die Bibel gestattet keine menschlich bildhafte, und damit auch sexuelle Fixierung Gottes. Unser „Vater im Himmel“ dient als Bild, ist eine Hilfe, aus unserer menschlichen Erfahrungswelt, um mit Gott, der über alle Namen und Bilder ist, in Beziehung treten zu können. Mehr nicht. Der Begriff „Mutter“ mag gendermäßig gefordert werden, trifft aber ebenso wenig die Wirklichkeit, die wir mit Gott meinen.
In der jüdischen Überlieferung allerdings gab es schon sehr früh die Beobachtung von zwei Seiten Gottes. Der jüdische Maler Marc Chagall hat diesen Topos von den „beiden Seiten Gottes“ in seinem Bild von der Vertreibung aus dem Paradies künstlerisch umgesetzt. Der Engel, der Adam und Eva aus dem Paradies hinausweist, hält in der linken Hand eine Art Schwert-Stab, der rechte Arm dagegen nimmt eine umarmende Haltung ein. Der Theologe und Chagall-Kenner Christoph Goldmann deutet es so: Alles Tun des Menschen wird schicksalhafte Folgen haben, die von der Tat des Menschen ausgehen.
Gott lässt die Konsequenzen zu, die sich aus dem Handeln der Menschen ergeben, aber der zur Umarmung bereite Arm des Engels deutet schon an, dass Gott den Menschen in allem Schlamassel, das er angerichtet hat, nicht alleine lässt. Er ist der Gott väterlicher Konsequenz, aber ebenso mütterlichen Erbarmens, zumindest im Denken biblischer, patriarchalischer Zeit.
Zwei Gottesnamen als Ursprung der »beiden Seiten Gottes«
Vermutlich hängen die „beiden Seiten Gottes“ von zwei Gottesnamen ab, die in der hebräischen Bibel, dem sogenannten Alten Testament, genannt sind: Jahwe (JHWH) und El (Elohim). Die Ursprünge der vorbiblischen Gottheit Jahwe waren wohl nomadische Gruppen in Nordarabien und Südpalästina, sehr wahrscheinlich identisch mit den Midianitern, östlich des Roten Meeres, zu denen Mose fliehen musste, nachdem er einen Ägypter getötet hatte. Die Berge Horeb und Sinai sind als Ausgangs- und Ereignisorte genannt. Jahwe war gewissermaßen ein Gott der Berge und der Wüste.
Der biblische Text deutet ihn als „Ich bin, der ich sein werde“, wie er sich dem Mose am Dornbusch geoffenbart hat. Er wird zum Gott der Befreiung und der Verheißungen. Diese Vorstellungsformel drückt sowohl seine Unverfügbarkeit aus wie auch seine Treue. Interessant ist nun der Fund einer Segensformel „JHWH und seine Aschera“ auf einer Tonscherbe, die im Jahre 1975 gefunden worden ist. Wir dürfen davon ausgehen, dass ursprünglich die beiden genannten Gottheiten Jahwe und El in vorbiblischer Zeit jeweils eine Göttin an ihrer Seite hatten.
Im Unterschied zu Jahwe, dem Gott der Berge und der Wüste, war El oberster Gott in einem Götterpantheon und kam aus einem Kulturland. Er hat seinen Weg von Ugarit, von Norden her, zu den Kanaanäern und später zu den Israeliten gefunden. Mit seinem Namen wird die Schöpfung verbunden. In einem langen Prozess fanden die Israeliten in Kanaan Ihre Bleibe. In mindestens zwei redaktionellen Zusammenführungen verschiedener Quellen werden mit zunehmender Integration im Kulturland ebenso die beiden Gottheiten Jahwe und El allmählich gleichgesetzt.
Das heutige Gottesbild entsteht
Spätestens nach der Zeit des babylonischen Exils (etwa ab 500 v.Chr.), schälte sich jenes Gottesbild heraus, wie wir es nach biblischem Zeugnis kennen und dieses auch so übernommen haben: ein rein transzendenter, männlicher Gott, der keine anderen Götter und Göttinnen neben sich duldet. Er ist Schöpfer und Erhalter, Befreier und Garant für zugesagte Verheißungen. Erinnerungen an frühere Götter und Göttinnen werden eliminiert.
Der streng monotheistische Gott der Bibel ist also nicht vom Himmel gefallen, sondern hat sich in mehreren Jahrhunderten herauskristallisiert.
Wie offen und dynamisch sich Religion aber auch weiterentwickeln kann, belegt die Weisheitsliteratur der Bibel. Unter dem Einfluss ägyptischer und griechischer Kultur entstanden ab ca. 200 v. Chr. Schriften, die uns nicht in hebräischer, sondern nur in ursprünglich griechischer Sprache erhalten sind. Sie verbinden, nicht ganz konfliktfrei, jüdischen Glauben mit griechischem Gedankengut. Zu nennen sind vor allem das “Buch der Weisheit” und “Das Buch Jesus Sirach”.
Die Weisheit wird in diesen Büchern dem Leser und Hörer als Frau vorgestellt, die vor aller Schöpfung göttlichen Ursprungs war und unvergänglich bleibt. Sie wirkt im Kosmos und unter den Völkern, sie wird in Jerusalem im heiligen Tempel wohnen.
Schechina – die Gegenwart Gottes
Die Präsenz Gottes im Tempel von Jerusalem ist eine alte Vorstellung davon, wie Gott in der Welt einwohnt. Sie wird die „Schechina“ genannt und meint die Gegenwart Gottes. Nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 n. Chr. wurde die „Schechina“ demzufolge als verborgene Einwohnung Gottes in der gesamten Schöpfung und damit auch im Menschen geglaubt.

Christian Wiese (Martin-Buber-Lehrstuhl, Frankfurt) beschreibt das Konzept der „Schechina“ als weibliche Seite Gottes so: „Die Schechina in ihren vielen unterschiedlichen Gestalten ist der Kontrapunkt des Göttlichen zur materiellen Welt. Sie wird weiblich gedacht.“
Anselm Kiefer hat sie als Skulptur dargestellt, die bereit ist, die göttlichen Eigenschaften in sich aufzunehmen. Der eine Gott, der nach dem Buch Genesis den Menschen als Mann und Frau erschaffen hat, bildet somit in sich beide Seiten ab, ohne seine Einheit zu verlieren.
Fotos: © Anselm Kiefer / Jüdisches Museum Frankfurt; Header: © Ahkka/photocase.com